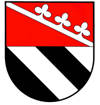Heimat für Fremde
Berkenthin ist in den verschiedenen Zeiten immer wieder Heimat für geflüchtete Menschen geworden. Einen ersten Flüchtlingszuzug gab es bereits im Ersten Weltkrieg, als Menschen aus dem von den Russen besetzten Masuren hier vorübergehend untergebracht wurden. Aber während die meisten von ihnen später in ihre Heimat zurückkehren konnten, setzte am Ende des Zweiten Weltkrieges eine ungleich größere Fluchtbewegung ein. Für viele Geflüchtete aus den ehemals deutschen Ostgebieten wurde Berkenthin neue Heimat.
In dieser Chronik haben Sie etwas darüber erfahren, wie während der letzten Kriegswochen täglich Tausende von Heimatvertriebenen den Ort in Richtung Westen passierten. Aber viele von ihnen blieben, konnten sie sich hier doch zunächst in Sicherheit vor der anrückenden Roten Armee wähnen. Hinzu kamen viele Ausgebombte, vor allem aus Hamburg, aber auch aus anderen Städten. Man traf damals, so eine zeitgenössische Aussage, auf den Straßen mehr Fremde als Einheimische! Dabei wurden diese nicht immer und überall bereitwillig und freundlich aufgenommen. Vor allem Konflikte um den knapp gewordenen Wohnraum waren an der Tagesordnung.
Tatsächlich stieg die Einwohnerzahl Berkenthins, die vor dem Krieg einschließlich der damals zugehörigen Dörfer Gödenitz und Hollenbek knapp über 800 betragen hatte, auf weit über 2000 in den Jahren 1945 und 46. Im Rahmen der Umsiedlungsprogramme nach dem Krieg wurden viele von ihnen in den folgenden Jahren in die industriellen Gegenden West- und Südwestdeutschlands umgesiedelt, aber viele blieben und fanden hier dauerhaft eine neue Heimat. War man zunächst äußerst notdürftig in den fremden Wohnungen, Scheunen und Ställen oder auf Sälen oder im ehemaligen RAD-Lager untergekommen, entstanden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neue Häuser und Siedlungen, die das Bild des Ortes veränderten. Der Name „Hamburger Straße“ erinnert beispielsweise heute noch daran, dass hier Hamburg-Evakuierte eine neue Heimat fanden, woanders, z.B. im Drosselweg, entstanden mit Hilfe staatlich geförderter Wohnungsbauprogramme noch in den 60er Jahren kleine landwirtschaftliche Nebenerwerbssiedlungen für Heimatvertriebene.
Aber auch in den letzten Jahren sind wieder viele Menschen aus allen Teilen der Erde auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Elend und Not zu uns gekommen. Einige von ihnen sind geblieben bzw. werden bleiben und das Erscheinungsbild Berkenthins noch einmal wieder nachhaltig verändern. Auch für diese Menschen ist unser Ort neue Heimat geworden.
In diesem Teil der Chronik werden wir versuchen, exemplarisch einige Schicksale zu porträtieren. Ein kleiner Anfang ist gemacht, andere Fälle werden folgen! Auch hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Die Flucht aus Letschin
Die vielen noch bekannte inzwischen verstorbene Groß Berkenthinerin Gisela Sperling wurde 1923 in Letschin im Oderbruch geboren, einem lange Zeit landwirtschaftlich geprägten Ort, der aber mit seinen Geschäften, Schulen im späten 19. Jahrhundert kleinstädtischen Charakter erhielt. Das Wahrzeichen des Ortes war seit 1905 ein Standbild Friedrichs II., der im 18. Jahrhundert die Trockenlegung des Oderbruch verfügt hatte.

Das 1905 eingeweihte Standbild Friedrichs II.
Aus dem Ort stammten noch weitere später in Berkenthin ansässig gewordene Familien, so die Familie Tilicke und die Familie Haake. Der Ort Letschin hänge an vier „Ha(a)ken“, habe es damals geheißen, erinnerte sich Gisela Sperling im Gespräch humorig. Damit spielte sie darauf an, dass es mehrere Linien der wohlhabenden Familie Haake in dem Ort gab, die in den verschiedenen Ortsteilen entsprechend große Häuser bewohnten. 1945 lebte sie selbst noch als junges Mädchen auf dem ca. 30 Morgen großen Bauernhof ihrer Eltern. Sie hatte Hauswirtschaft gelernt und träumte davon, auf die Schule in Frankfurt / Oder zu gehen, mit dem Ziel, eines Tages Mamsell in einem großen Haushalt zu werden. Schon seit der Jahreswende 1944/45 hatten immer wieder Flüchtlingstrecks aus den deutschen Ostgebieten auf der Flucht vor der Sowjetarmee den Ort in Richtung Westen passiert, bevor man schließlich selbst in die Frontlinie der Schlacht um Berlin zu geraten drohte. In den Monaten März und April machten sich nun auch mehr und mehr Familien aus Letschin selbst auf die Flucht. Aber Giselas Vater zögerte noch. Sie erinnerte sich, dass sie im Frühjahr noch zusammen mit ihrem Vater die Felder bestellt habe. Und auch der jüngere Bruder Arno wurde noch in seiner Heimatgemeinde konfirmiert, obwohl die Rote Armee bereits am Ostufer der Oder für den Sturm auf Berlin Stellung bezogen hatte. Erst unmittelbar vor dem Beginn der Schlacht um die Seelower Höhen, die am 16. April 1945 begann, verließ schließlich auch die Familie, zu der neben den Eltern und zwei Geschwistern die Großeltern gehörten, die damals schon über 80 Jahre alt waren, ihren angestammten Besitz. Nur das unbedingt zum Leben Nötige wurde auf die 2 Leiterwagen geladen: Lebensmitte, darunter Töpfe und Kannen mit Sirup, Fett und Zucker, Kleidung und Bettzeug. Aber auch Futter für die vier Pferde musste mitgenommen werden. Frau Sperling wusste noch, dass sie und ihre Schwester auch noch ihre Fahrräder mitnahmen, auf denen sie während der Flucht häufig neben den Leiterwagen herfuhren, was aber wegen der oft ausschlagenden Pferde nicht ganz ungefährlich war. Ansonsten wurden die Räder hinten an die vollgeladenen Fuhrwerke gebunden. Da die wichtigsten Straßen den Militärfahrzeugen vorbehalten waren, bewegte sich der Treck, in den man schließlich eingebunden war, meist auf kleineren Nebenwegen immer weiter nach Westen, lediglich kaum mehr als einen Tag vor den anrückenden Russen und immer in Furch vor angreifenden Tieffliegern. Aber man kam nur langsam voran, oft staute sich der Teck und man kam stundenlang nicht von der Stelle. Nachts wurde in Scheunen, in Ställen oder auf Heuböden geschlafen, und wenn man Glück hatte, konnten die Frauen in den Küchen der Bauernhäuser etwas zu essen kochen. Zumindest mit dem Wetter hatte man Glück, da das Frühjahr 1945 außergewöhnlich mild war, so dass man immerhin nicht zu frieren brauchte.

Aufgrund des Maßstabes dürfte sie den Flüchtenden kaum mehr als eine grobe Orientierung gegeben haben.
Zu den schlimmsten Erinnerungen der Flucht gehörte für Gisela Sperling der Anblick vieler gestorbener oder getöteter KZ-Häftlinge in den Straßengräben. Sie stammten wahrscheinlich aus dem ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen, welches in den Morgenstunden des 21. April 1945, als die Rote Armee nur noch wenige Kilometer entfernt war, von der SS geräumt wurde. 33.000 waren in Gruppen von 500 Häftlingen nach Nordwesten in Marsch gesetzt. Viele Häftlinge, die am Tag zwischen 20 und 40 Kilometer marschieren mussten, starben an Entkräftung oder wurden von der SS erschossen. Frau Sperling erinnerte sich, dass sie als junges Mädchen ahnungslos ihre Mutter fragte: „Mama, warum liegen diese Menschen in den Gräben?“
Nach Tagen der Flucht, Gisela Sperling konnte nicht mehr genau sagen, wie lange man unterwegs war, wurde der Treck in der Nähe von Wittenberge von der Roten Armee eingeholt und zunächst an der Weiterfahrt gehindert. Man verbrachte tagelang auf freiem Feld, wobei man keinerlei Vorstellung davon hatte, wie es weitergehen würde. „Man hat nur von einem Tag auf den anderen gedacht“, so Frau Sperling. Aber immerhin erinnerte sie sich an keinerlei gewalttätige Übergriffe der gefürchteten Sowjetsoldaten auf Flüchtlinge. Groß war die Freude aber, als man hier alte Bekannte aus dem Heimatort wiedertraf, nämlich die Familien Haake und Tilicke, die es offensichtlich über andere Fluchtwege in dieses Lager bei Wittenberge verschlagen hatte. Man beschloss von nun zusammen zu bleiben. Und tatsächlich wurde ihnen nach Tagen des Wartens erlaubt weiter zu ziehen, bis dann in der Hagenow der Treck wieder für Tage stockte. Inzwischen war der Krieg vorbei, aber für die Bevölkerung war noch unklar, wo letztendlich die Demarkationslinie zwischen Russen, Amerikanern und Engländern verlaufen würde. Immerhin befand man sich inzwischen im britischen Besatzungsgebiet, aber Gerüchte besagten, dass die endgültige Demarkationslinie weiter nach Westen verlegt werde. Also ging es im Treck in Furch vor den Übergriffen der Sowjetsoldaten weiter nach Westen, nach Schleswig-Holstein, wo man zu Verwandten wollte. Über verstopfte Straßen passierte man Ratzeburg weiter in Richtung Oldesloe. In Berkenthin, so erinnerte sich Gisela Sperling an ihre ersten Eindrücke, ging es dann nicht weiter, weil die britische Besatzungsmacht die Brücken über den Elbe-Lübeck-Kanal für Flüchtlinge gesperrt hatte, offensichtlich um den nicht enden wollenden Flüchtlingsstrom in die eigene Besatzungszone zu regulieren. Obwohl die Familie eigentlich geplant hatte, weiter ins Landesinnere zu fahren, ging es auch nach tagelangem Warten nicht weiter. Statt dessen wurde der Treck in Kählstorf auf verschiedenen Bauernhöfen untergebracht. Damit endete die Flucht eher zufällig in Berkenthin!
Weit verbreitet war in diesen Tagen die Auffassung, die Rote Armee würde sich bald wieder hinter die Oder zurückziehen und man würde wieder in die Heimat zurückkehren können. Aber die Hoffnung erfüllte sich nicht. So wurden die Letschiner Familien schließlich in Berkenthin sesshaft. Hier gründete auch Gisela Sperling ihre Familie, die inzwischen seit Jahrzehnten im Ort ansässig ist.
(Aufgezeichnet nach einem Gespräch 2019)
Von Niederschlesien nach Berkenthin

Christa Rodemann, geborene Schober, heute seit vielen Jahren im Drosselweg in Klein Berkenthin lebend, strandet mit ihrer Familie nach dem Krieg nach einer langen Odyssee zunächst in Göldenitz und schließlich in Berkenthin. Sie stammte aus Schreibersdorf, einem langgestreckten, 7 km langen Straßendorf im ehemaligen Landkreis Lauban in Niederschlesien, das bereits vor dem Krieg an die 2000 Einwohner hatte. Dort wurde sie 1933 geboren und dort verbrachte sie zusammen mit vier Geschwistern ihre Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof. Zur Zeit der Flucht war der älteste Bruder irgendwo als Soldat im Krieg, ein anderer Bruder war mit 17 Jahren in den letzten Kriegswochen gefallen, nachdem er, nur notdürftig ausgebildet, mit anderen seines Jahrgangs an die Ostfront geworfen worden war. Eine ältere Schwester war seit Jahren beruflich in Berlin tätig.
Im Winter 1944 /45 wurde Niederschlesien Kampfgebiet. Im Februar 1945 wurde dann die Stadt Lauban zum großen Teil von der Roten Armee eingenommen, wurde aber im März von deutschen Truppen zurückerobert. Deshalb inszenierte Reichspropagandaminister Joseph Goebbels hier, nur wenige Kilometer von Schreibersdorf entfernt, seinen letzten berühmten Wochenschauauftritt mit den damals üblichen Durchhalteparolen. Nach Kriegsende wurde Schreibersdorf von der sowjetischen Besatzungsmacht unter polnische Verwaltung gestellt und heißt heute Pisarzowice.
Als sich die Front dem Ort näherte, machte sich die Familie Schober wie andere Familien aus dem Ort auf die Flucht vor der anrückenden Roten Armee. Nur unbedingt zum Überleben Notwendiges hatte man auf einen Wagen geladen, der mit einer Plane überspannt war und von zwei Pferden gezogen wurde. Neben der Mutter und einer Schwester mussten auch noch die weit über siebzig Jahre alte Oma sowie eine Tante und ein Cousin Platz finden. Der Vater war zum Volkssturm eingezogen worden und musste deshalb im Ort bleiben, er fand erst lange nach dem Krieg wieder zu seiner Familie zurück. Christa Rodemann erinnert sich, dass man sich am 13. Februar 1945 auf die Flucht machte, just an dem Tag, an dem die Stadt Dresden von britischen und amerikanischen Bombern in Schutt und Asche gelegt wurde. Und sie weiß noch, wie der Treck später an der noch brennenden und qualmenden Stadt vorbeikam.
Man hatte sich den Wagen des benachbarten Gutes angeschlossen, dessen Besitzer Rohwedder aus Reinsdorf in Mecklenburg stammte und sich in das Gut eingeheiratet hatte. Dieser führte nun die Wagen des kleinen Trecks quer durch Mitteldeutschland in seine alte mecklenburgische Heimat. Zu dem kleinen Treck gehörte u.a. auch die ebenfalls aus Schreibersdorf stammende Familie Meissner, die auch in Gödenitz und dann in Berkenthin ansässig wurde. Manfred Meissner gründete hier später das gleichnamige Baugeschäft. Man fuhr tagsüber, zunächst an der Elbe entlang immer in Richtung Norden. Übernachtet wurde auf Höfen oder in Scheunen oder in Turnhallen. Manchmal fuhr die Mutter auf dem Fahrrad, das man mitgenommen hatte, dem Treck voraus, um nach einer geeigneten Unterkunft für die Nacht Ausschau zu halten.
Am 9. März kam man immerhin wohlbehalten in dem kleinen Ort Reinsdorf in der Nähe von Neukloster an, wo der ganzen Familie Schober in kleines Zimmer zugewiesen wurde. Hier in dieser Enge starb dann die alte Großmutter, die noch auf dem Friedhof in Neukloster beerdigt wurde. Aber damit war die Flucht noch nicht zu Ende. Ende April ging es weiter, immerhin war unklar, wo später einmal die Demarkationslinie zwischen den Besatzungsmächten verlaufen würde. Christa Rodemann erinnert sich noch heute, dass es immer auf der ehemaligen Reichsstraße 208 an Wismar vorbei immer weiter nach Westen ging. Man landete schließlich in Klein Thurow, das damals noch als eigenständige Gemeinde zum Herzogtum Lauenburg gehörte. Und genau durch diesen Ort verlief auch zunächst die Demarkationslinie zwischen der sowjetischen und der britischen Besatzungsmacht, wobei die Flüchtlinge aus Schreibersdorf im britischen Teil des kleinen Ortes untergebracht wurden. Man verbrachte den ganzen Sommer 1945 zunächst in einer Scheune, später wurde der Familie ein Zimmer zugewiesen. Aber auch an eine lustige Begebenheit in dieser schweren Zeit erinnert sich Christa Rodemann: Als Kind konnten sie und ihre Altersgenossen beobachten, wie im russisch besetzten Teil des kleinen Dorfes russische Soldaten versuchten, dass Fahrradfahren zu lernen und dabei immer wieder zu Fall kamen. Noch Jahrzehnte später erinnert sie sich amüsiert an die ungelenken Versuche, die sich dort unter ihren Augen abspielten.
Im November des Jahres wurde dann zwischen den Besatzungsmächten in dem Barber-Ljaschtschenko-Abkommen der Tausch von Gebieten östlich des Ratzeburger Sees und des Schaalsees vereinbart. Auf diese Weise kamen die Nachbargemeinden Ratzeburgs – Ziethen, Mechow, Bäk und Römnitz – am 26. November 1945 zum Kreis Herzogtum Lauenburg und von der sowjetischen Besatzungszone zur britischen Besatzungszone. Sie gehörten zuvor zum mecklenburgischen Landkreis Schönberg. Im Austausch kamen die lauenburgischen Gemeinden Dechow, Groß und Klein Thurow und Lassahn zur sowjetischen Besatzungszone. Das Abkommen sah vor, dass die Räumung der Gebiete am 28. November 1945 um 13 Uhr Berliner Zeit beendet sein musste. Die Aussicht, damit unter die Kontrolle der Roten Armee zu kommen, veranlasste die im Ort untergebrachten Flüchtlinge zusammen mit vielen Bewohnern des Ortes, die Flucht fortzusetzen. Inzwischen hatte auch die Familie Schober keine Pferde mehr, Tochter Christa erinnert sich nicht, was mit ihnen geschehen ist. Aber immerhin war diese letzte Fluchtetappe von höherer Stelle organisiert worden, denn sie wurden zusammen mit anderen Flüchtlingsfamilien mit Pferdegespannen aus Göldenitz abgeholt. Dort angekommen war auch ihre Unterbringung organisiert, und zwar wurde der ganzen Familie ein Zimmer bei Bauer Kahts zugeteilt. Hier in Göldenitz endete denn auch vorläufig die Flucht aus der Lausitz.

Im Laufe der folgenden Jahre normalisierte sich unter schwierigen Umständen so langsam das Leben der Flüchtlinge in der neuen Heimat. Die versprengten Familienmitglieder fanden wieder zusammen und auch der Vater stieß nach einem eigenen schwierigen Weg wieder zur Familie. Der Vater arbeitete in der Landwirtschaft und später im Sägewerk Rave und Christa beendete ihre Schullaufbahn an der Berkenthiner Schule. Sie erinnert sich noch an die Lehrer Kara, Dresow und Lübcke, den sie in besonders positiver Erinnerung behalten hat. Konfirmiert wurde sie von dem strengen Pastor Bluck. Nach der Schule war sie in „Stellung“ auf verschiedenen Höfen, u.a. in Göldenitz und in Klinkrade. An eine Berufsausbildung für ein junges Mädchen war in diesen Jahren nicht zu denken, man war froh, wenn man überhaupt eine Anstellung fand und sein Auskommen hatte. Immerhin hatte man in der Landwirtschaft keinen Hunger zu erleiden.
Jahre später lernte sie ihren Ehemann Gerhard Rodemann kennen. Die Familie Rodemann stammte ursprünglich aus Mecklenburg, hatte dann während des Krieges im Warthegau gelebt und war durch die Wirren am Ende des Krieges ebenfalls in Schleswig-Holstein gestrandet.

1964 konnte das Ehepaar im Drosselweg in Klein Berkenthin ihr Haus bauen, in dem Christa heute immer noch lebt. Es war eins von insgesamt 7 baugleichen Häusern, die alle im Rahmen eines Programms zum Bau von Nebenerwerbssiedlungen errichtet wurden. Der Drosselweg selbst wurde damals für dieses Siedlungsprojekt neu angelegt. Die Häuser waren geflüchteten Landwirten vorbehalten, so dass das Grundstück auch offiziell nur von Vater Schober gekauft werden konnte. Zu allen Häusern gehörten ein großes Grundstück und ein kleiner Stall, der u.a. die Haltung von Schweinen erlaubte, wodurch die Selbstversorgung der Familien gewährleistet werden sollte. Da das Geld in dieser Zeit bei allen Bauherren knapp war, musste viel in Eigenleistung geschafft werden. So schachtete Gerhard Rodemann zusammen mit seinem Schwiegervater in mühevoller Handarbeit den Keller seines Hauses mit Schaufel und Spaten aus.

Grundsätzlich wurden die Häuser aber nacheinander von denselben Baufirmen ausgeführt. Heute sind die Häuser der ehemaligen Bauherren Gerhard Rodemann, Willy Rodemann, Zander, Tew, Bockwoldt, Kaulke und Haake in der Regel verändert und modernisiert worden, aber die ehemalige landwirtschaftliche Nebenerwerbssiedlung ist immer noch zu erkennen. Alle diese Familien hatten in Berkenthin eine neue Heimat gefunden.
(Aufgeschrieben nach einem Gespräch im September 2023)