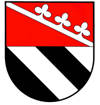Das Kirchspiel
Wollen wir etwas über die Anfänge der „Schönsten Kirche der Welt“ in Erfahrung bringen, müssen wir in die Zeit des Hochmittelalters reisen, in eine Zeit also, aus der in unserer Gegend kaum schriftliche Aufzeichnungen erhalten sind. Die ersten schriftlichen Erwähnungen unserer Kirchengemeinde sind in der Tat so spärlich, dass wir ein wenig auf unseren detektivischen Spürsinn angewiesen sind. Dennoch bleibt das genaue Entstehungsjahr Kirche im Dunkel. Es liegen uns weder Pläne noch sonstige Aufzeichnung zur eigentlichen Baugeschichte vor, keine Zeichnungen, keine Berichte, die uns genaue Hinweise geben könnten. Wir können aber davon ausgehen, dass die Entstehung des Kirchspiels Berkenthin in die Jahre zwischen 1195 – 1235 fiel. Denn in einer Urkunde des Bischofs Isfridus zu Ratzeburg vom Jahre 1195 wurden nur die Kirchen von St. Georg, Mustin, Seedorf, Sterley, Gudow, Breitenfelde und Nusse genannt, Berkenthin aber nicht erwähnt. Von Berkenthin hören wir erst im Zehntregister des Bistums Ratzeburg aus dem Jahr 1230, das im Grunde genommen einem Steuerregister gleichkommt. Der Bischof hatte durch einen Schreiber eine Liste von den Dörfern bzw. Personen anfertigen lassen, die zu Steuerzahlungen an ihn verpflichtet waren.

Bischof Gottschalk hatte das Bischofsamt in den Jahren 1229 – 1235 inne. Vor 1229 und nach 1235 kann dieses Register also nicht verfasst worden sein. Wie bereits an anderer Stelle dieser Chronik ausführlicher dargestellt, wurde hier die Parochie (Kirchspiel) Paketin erwähnt, zu der damals die Dörfer Paketin, Guldenice (Göldenitz), Ciresrode (Sierksrade), Hakenbeke, Climpowe (Klempau) , Slavicum Paketin (Klein Berkenthin) gehörten. Zuvor war Berkenthin Teil des Ratzeburger Kirchspiels St. Georg, das aber wegen seiner Größe eher ein Missionsgebiet denn einer Parochie glich. Auch einige der anderen neu entstandenen Kirchspiele waren wie Berkenthin von St. Georg abgeteilt worden. In den folgenden Jahrzehnten erfolgten dann noch weitere Neugliederungen des Bistums. So wurde beispielsweise 1286 Kastorf, dass offenbar auch zum Kirchspiel Berkenthin gehörte, abgetrennt und zur kleinen und deshalb armen Kirche zu Siebenbäumen gelegt.

Eine Steuerliste des Bischofs Marquardus aus dem Jahre 1320 zeigt, so dass die heutige Kirchenstruktur Lauenburgs bereits in dieser frühen Zeit in ihren Grundzügen vollendet war. Es war die Zeit der deutschen Kolonisation des Ratzeburger Landes, als die Ratzeburger Grafen bzw. später die Herzöge in allen Teilen des Heiligen Römischen Reiches unter Zusage von Grund und Boden Siedler anwarben, um das Land zu erschließen. Da aber nur ein christliches Land nach geltendem Recht zehntpflichtig, d.h. abgabenpflichtig gemacht werden konnte, war die deutsche Besiedlung mit der kirchlichen Durchgliederung des Landes verbunden. Je mehr christliche Gemeinden es gab, desto größer waren die Einkünfte des Landesherren und des Bischofs. Folglich erlebte das Lauenburger Land in jenen Jahrzehnten eine äußerst rege Kirchenbautätigkeit. Dabei ist in Berkenthin davon auszugehen, dass bereits eine deutsche Angersiedlung entlang der heutigen Ratzeburger Straße existierte, bevor mit dem Kirchenbau begonnen wurde. Dafür spricht, dass der Standort der Kirche außerhalb dieser damaligen Siedlung lag und nicht in ihrer Mitte, wären Ort und Kirche gleichzeitig entstanden, hätte man die Kirche in der Mitte des Ortes vermuten müssen.

Interessante Baugeschichte
Wie mag es wohl zugegangen sein beim Bau dieser Kirche? Gut gewählt war der erhöhte Standort mit tragfähigem Untergrund hoch über der Stecknitzniederung. Eine reges Treiben wird auf dieser großen Baustelle geherrscht haben. Wie überall im Kolonisationsgebiet wurden die Bewohner des ganzen Kirchspiels von der Obrigkeit zu Hand- und Spanndiensten verpflichtet.
 Da waren Männer, vielleicht sogar Frauen, damit beschäftig mit einfachen, teilweise noch aus Holz gefertigten Spaten und Schaufeln den Baugrund zu ebnen und mit Schubkarren Boden abzufahren, während gleichzeitig Feldsteine für das Fundament aus den umliegenden Feldern von großen Leiterwagen angefahren wurden. Seit dem 13. Jahrhundert war man dazu übergegangen steinerene Gebäude aus Ziegeln zu errichten. Einerseits, weil der hier vorkommende Naturstein Granit nur schwer zu bearbeiten war, aber auch weil dieser nicht in ausreichenden Mengen vorhanden war.
Da waren Männer, vielleicht sogar Frauen, damit beschäftig mit einfachen, teilweise noch aus Holz gefertigten Spaten und Schaufeln den Baugrund zu ebnen und mit Schubkarren Boden abzufahren, während gleichzeitig Feldsteine für das Fundament aus den umliegenden Feldern von großen Leiterwagen angefahren wurden. Seit dem 13. Jahrhundert war man dazu übergegangen steinerene Gebäude aus Ziegeln zu errichten. Einerseits, weil der hier vorkommende Naturstein Granit nur schwer zu bearbeiten war, aber auch weil dieser nicht in ausreichenden Mengen vorhanden war.
So errichtete man eine Ziegelei um Backsteine und Pfannen zu produzieren. Dies war dank der tonreichen Böden und der riesigen Wälder als Brennstofflieferanten im Umland die gängige Alternative.
Die Herstellung der Ziegel
Das Brennen solch großer Mengen von Ziegeln erforderte neben dem nötigen Tonmaterial, das in der Umgebung Berkenthins zur Genüge vorhanden war, jede Menge Brennmaterial, vor allem Holz. Und da zu jener Zeit nicht nur die hiesige Kirche erbaut wurde, sondern zeitgleich auch in anderen Dörfer Backsteinkirchen errichtet wurde, ist der Raubbau an den Wäldern in jener Zeit kaum zu überschätzen. Wenn wir uns aber vergegenwärtigen, dass noch im Hochmittelalter weite Teile unseres Landes mit Wäldern bedeckt waren, in denen sich nur vereinzelt um die Dörfer herum gerodete Siedlungsinseln fanden, so wird deutlich, dass zunächst noch kein Mangel an dem benötigten Bau- und Brennholz herrschte. Das änderte sich dann allerdings in späteren Jahrhunderten, als Holz mehr und mehr zu einem begehrten knappen Gut wurde.

Bis zur Anlage ortsfester Ziegeleien wurden die Backsteine im Feldbrandverfahren am Ort des Lehmabstichs hergestellt. Die Ziegler, in der Regel Wanderarbeiter, die auch beim Berkenthiner Kirchenbau für einige Jahre eine Anstellung gefunden haben dürften, formten die Ziegel zunächst Stück für Stück von Hand. Kein handgemachter Ziegel glich dem anderen, anders als die heutigen industriell gefertigten. Sie stapelten nach einem bestimmten Bauplan die getrockneten Lehmkuchen zu Öfen, unter Auslassung von Kanälen, die mit Kohle gefüllt wurden. Solche Feldbrandmeiler, deren Kuppeln mit Lehm verstrichen wurden, bestanden aus ca. 40 000 Backsteinen. Das Feuer fraß sich mehrere Tage lang von einem Schürgang aus von unten nach oben. Je nach Lage der Steine zur Mitte oder zum Rand hin waren sie härter oder weniger hart gebrannt und wurden so vom Maurer entweder für die Außenhaut eines Gebäudes oder für das innere Mauerwerk verwendet. Archäologische Spuren, wo sich diese Meiler befunden haben, findet man allerdings in der Berkenthiner Gegend nicht mehr, da für die Errichtung eines solchen Ofens nur die oberste Bodenschicht abgetragen und die Flächen später häufig beackert wurden. (Vgl. dazu Saß, F. 2002: Gestaltete Ziegel. In: Ernstling, F.; Saß, F.; Schulze, E. & Witzke, H: Mecklenburg-Strelitz – Beiträge zur Geschichte einer Region. Band 2. Friedland: 400–410)
Rege Bautätigkeit über viele Jahre
Am bereits im Bau befindlichen Chor waren Arbeiter unablässig damit beschäftigt, auf Tragen Steine und sonstiges Baumaterial über steile Leitern zu den Maurern zu transportieren, die mit Mörtel Stein um Stein zusammenfügten. Daneben waren Zimmerleute am Werk um Baumstämme grob zu behauen oder Baugerüste zu zimmern und über allem wachte der erfahrene Kirchenbaumeister, der vielleicht aus Lübeck oder von noch weiter her kam und hier in Berkenthin für einige Jahre eine Anstellung fand. Gebaut wurde im Stil der Zeit, wir reden vom sogenannten Übergangsstil, romanischer und gotischer Baustil gingen ineinander über.

Dabei dominierte vom Grundriss her der bis dahin vorherrschende wuchtige romanische Baustil, während beispielsweise schon die hohen Fenster mit ihren Spitzbögen den Einfluss der Gotik zeigten, der mehr und mehr in Mode kam und z.B. im Bau der Marienkirche zu Lübeck ihre Vollendung fand.
Sicherlich hat es lange gedauert, bis die Kirche ihre heutige Gestalt annahm, man geht davon aus, dass der Chor Mitte des 13. Jahrhunderts entstand, das Langhaus gegen 1260, der wuchtige Kirchturm wohl Ende des 13. Jahrhundert fertiggestellt wurde, während laut Haupt die Bauweise der Portale auf die Zeit um das Jahr 1300 deutet. Im Laufe der Jahrhunderte ist dann das Bauwerk durch Brände, Unwetter, Kriegseinflüsse zumindest in Teilen wiederholt zerstört worden, wodurch sich auch immer wieder das Aussehen verändert haben dürfte. So beklagte der Lübecker Chronist Detmar 1386, dass es in der dritten Adventswoche des Jahres ein Unwetter gegeben habe, dem der Turm (torn) zu Berkenthin neben anderen Gebäuden zum Opfer gefallen sei. Allerdings ist man sich in der Deutung dieser Textstelle nicht ganz einig, ob es sich dabei tatsächlich um den Kirchturm oder den Turm einer Burganlage gehandelt haben könnte. Gesichert ist aber, dass infolge eines Blitzschlages im Juli 1816 der Helm des Turms bis auf die massiven Mauern niederbrannte, wodurch zugleich die Orgel, die Turmuhr und die Glocken zerstört wurden. Der Wiederaufbau erfolgte in den Jahren von 1822 bis 25.

Der Turm erhielt nun eine steinerne Spitze mit vier Giebeln, aus deren Mitte sich ein kleiner hölzerner Turm erhob (siehe Bild unten von 1864). Diese Konstruktion gefährdete aber wegen ihres großen Gewichtes den Unterbau des Turms, so dass 1867 ein Umbau des Turmes erfolgte, der ihm seine heutige Gestalt verlieh.
Aus der vorreformatorischen Zeit (1230-1538) ist relativ wenig über die Berkenthiner Kirche bekannt. So kennen wir nur drei Pfarrer aus dieser Zeit mit Namen (s. Pfarrer und Pastoren bis 1885).
Reiche Kirchengemeinde wird verkleinert
Eine einschneidende Maßnahme für die Berkenthiner Pfarre war die Abtrennung des Dorfes Kastorf 1286 (MUBXXVA, 13788). Übersetzt aus dem Lateinischen lautet der Urkundentext:
„Konrad, durch die Gnade Gottes Bischof der Ratzeburger Kirche, an alle die das Überreichte sehen, Heil im Herrn Jesus Christus. Wir wollen, daß ihr alle erkennt, daß wir die offenen und besiegelten Urkunden der Herren Herzöge von Sachsen, Albrecht und Johann, gesehen und gelesen haben, deren Wortlaut folgender ist:
Wir, Albrecht, durch die Gnade Gottes, Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen und Burggraf von Magdeburg, wollen, daß zur Kenntnis aller gelange, daß wir mit erfolgter Einwilligung des ehrwürdigen Vaters, unseres Herrn Bischofs von Ratzeburg, das Dorf Kerstendorp [Kastorf], das zum Kirchspiel Parkentin [Berkenthin] gehört, der Kirchengemeinde Seuenbomen [Siebenbäumen] wegen ihrer Bedürftigkeit in der Absicht größter Güte, hinzufügen, da die Kirche in Parkentin [Berkenthin], so wird gesagt, Einkünfte im Überfluß habe, daß der Priester auch ohne die Einkünfte des besagten Dorfes ausreichenden Unterhalt haben könne. Deshalb wollen wir, kurz gesagt, daß die Einwohner des obengenannten Dorfes Kerstendorp [Kastorf] der Kirche in Seuenbomen [Siebenbäumen] so wie Pfarrkinder unterstellt werden und dem Priester seine Rechte gewährleisten und ihre Rechte andererseits von diesem empfangen. Damit aber die vorgenannten Bestimmungen unverbrüchlich befolgt werden, haben wir das präsentierte Schriftstück als ersichtliches Zeugnis durch Anhängung unseres Siegels bekräftigt. Gegeben zu Mölln im Jahre 1286, am Tage des seligen Papstes Gregor [12. März].
Wir bekräftigen daher die fromme Handlungsweise, die durch die Herren Herzöge oben vollzogen wurde, durch unsere Autorität, in dem Willen und in der Kraft des heiligen Gehorsams durch strengen Befehl verordnend, daß die Einwohner des Dorfes Kerstendorp [Kastorf], welches Standes sie auch seien, dem Priester in Seuenbomen [Siebenbäumen] als ihrem rechtmäßigen Lenker ehrerbietig gehorchen und von ihm die geistlichen Sakramente empfangen und verlangen sollen, indem sie seine heilbringenden Gebote fest befolgen und ihm nichtsdestoweniger die der Kirche zustehenden Rechte vollständig leisten. Gegeben im Jahre des Herrn 1286 am Tage der Apostel Philipp und Jakob [1. Mai].“
Verzeichniß aus dem Missalbuche [Messbuch] zu Perkentin, daß die Pastoren daselbst die Freiheit am Perkentinholze de anno 1399 u. 1400 (LASH Abt. 210 Nr. 3452 Anker Kopiar)
1504: Der Herzog Johann und sein Sohn Magnus gaben sechs neuen Canonicaten eben so viele Pfarrkirchen mit deren Einkünften her, die Kirchen nämlich zu Lauenburg und Stapel (beide zu Archidiaconaten erhoben), zu Siebeneichen, Büchen, Seedorf und Parkentin; der Bischof fügte die beiden Pfarrkirchen seines Stifts, Nusse und Herrnburg, zu zwei neuen Dompräbenden, hinzu.
Eintragung auf der ersten Seite des Taufregisters der Kirche Berkenthin 1672
Verzeichnis der Dörfer zu diesem Kirchspiel gehören:
Sächsich:
Groß Berkenthin
Goldenitz
Clempau
Kohlstorf
Lübsche:
Niendorf
Düchelstorf
Schirksrade
Rundtshagen
Halb lübsch, halb sächsisch
Klein Berkenthin
Verzeichnis daß Sie dem Pastoren zu leisten schuldig.
Groß-Berkenthin muß einmal im Jahr pflügen und Morgens des Pastoren Vieh hüten lassen s. das Korn halb Tag einführen.
Goldnitz muß Ihm mist führen undt 2 mahl pflügen u. mergeln
Clempau und Köhlstorf muß 2 mahl pflügen und anegen.
Niendorf muß 2 mahl misten und mergeln
Düchelstorf undt Schirksrade 2 mahl pflügen undt mergeln
Rundtshagen 2 mahl pflügen undt mergeln
Kl. Berkenthin 2 mahl pflügen und mergeln
Die Kätner in allen Dörfern müßen eggen. Die Insten undt Halbkätner müßen in der Ernte einen Tag mit der Hand dem Pastoren helfen.
Verzeichnis daß Sie dem Pastoren geben an Rog-Korn:
Die 4 Sachsen Dörfer geben dem Pastoren das Jahr ein gehäuftes Fatt rog-Korn der Kätner sowoll als der Insten.
1746 wird in das Pastorat eingebrochen. So sieht sich die Regieurng genötigt wiederholt darauf hinzuweisen (s. Rescript von 1742), dass die Dörfer einen Nachtwächter anstellen sollen.

Ein Lübecker in Berkenthin
Im Inneren bot sich dem Besucher vor der großen Renovierung 1899 noch ein vollkommen anderes Bild, wie das obige Foto zeigt und wie aus folgendem Bericht hervorgeht. Bis 1899 hatte das Kirchenschiff statt der heutigen Gewölbedecke eine schlichte Holzdecke, während der Altarraum bereits damals gewölbt war. Und anders als heute war der ganze Kirchenraum weiß getüncht. Zudem befand sich an der Südwand des Altarraums noch das Gestühl der Dorfschaft Klempau sowie die Prieche der Rondeshagener Gutsherren, an der Nordwand befand sich eine weitere geschlossene Empore, so dass der Altarraum insgesamt einen recht gedrungenen Eindruck machte. Ein namenloser Lübecker Reisender war anlässlich der Eröffnung der Oldesloe – Hagenower Eisenbahn auf die Berkenthiner Kirche aufmerksam geworden und stattete ihr einen Besuch ab. Er schrieb darin in den Lübecker Vaterländischen Blättern:

„Bei der aus Anlaß der Eröffnung der Hagenow—Oldesloer Eisenbahn unternommenen „Entdeckungsfahrt“ fiel mir das im Style der Vicelins Kirchen errichtete Gebäude auf und rief in mir das Verlangen wach, dasselbe einer Besichtigung zu unterziehen. Der freundliche Lehrer und Cantor des Ortes erklärte mir sofort seine Bereitwilligkeit, mir die Kirche zu zeigen, bedauerte aber des gerade stattfindenden Unterrichts wegen (der Lehrer hat nicht weniger als 98 Kinder in 2 Abtheilungen ganz allein zu unterrichten) nicht selbst mitgehen zu können, gab mir vielmehr seinen schon ziemlich erwachsenen Sohn als Begleiter mit. Die Berkenthiner Kirche liegt auf einer kleinen Anhöhe man gelangt in dieselbe, nachdem man den alten seit 10 Jahren nicht mehr benutzten Kirchhof überschritten hat. Durch eine kleine niedrige Doppeltür betritt man das Innere und empfängt zunächst, weil alles Holzwerk grau gestrichen und sich von den gleichfalls fast grau gestrichenen Wandflächen wenig abscheidet, einen etwas eintönigen Eindruck, doch hat sich das Auge erst gewöhnt und sieht die Einzelheiten genauer, so fällt zunächst der Blick auf die zwar einfache, aber recht pietätvolle Gedenktafel an die im Jahre 1870/71 im Kriege gegen Frankreich Gefallenen.
Wir finden dort folgende Inschrift: In diesem Kirchspiel starben für König und VaterlandHeinrich Plat aus Niendorf am 18. Aug. 1870. Johann Storm aus Rondeshagen am 21. Okt. 1870. Gleich daneben steht die kleine aus Holz erbaute, mit hübscher alter Malerei verzierte Kanzel, auf der in schwer zu entziffernder altdeutscher Frakturschrist zu lesen steht: „Gott zur Ehre, dieser Kirche zur Zierde haben diese Christliche hier benannten Männer diese Kanzel ausgeziert und vermahlen lassen. Gott sey dafür Ihre Belohnung.“ Es folgen dann 11 Namen.

Als Erbauungsjahr ist auf der Thür der Kanzel die Zahl 1696 verzeichnet. In recht krasser Malerei, dagegen in beachtenswerter Holzschnitzerei ist der Altar gehalten. Vier fast lebensgroße Figuren, die 4 Evangelisten darstellend, und Sinnbilder wie ein Löwe, einAdler, ein Stier und ein Engel zieren ihn neben mehreren Christusbildern. Vor dem Altar befindet sich, an einer langen Kette von der Kirchendecke herunter hängend, der „Taufengel,“ eine gleich krass roth und blau bemalte Holzfigur.
Zur Vornahme einer Taufhandlung, (Taufen werden hier in der Kirche vorgenommen) wird die Figur von ihrem erhöhten Hang herunter gezogen und mit einem Haken an die Altarschranke befestigt, um nach der Taufe wiederhochgeschoben zu werden. Den Gutsherrschaften der Umgegend, insbesondere derjenigen zu Rondeshagen (v. Schrader) ist ein besonderer in der Höhe des Chores belegener Stand eingeräumt. Die
Holzvergitterung an den Ständen erinnert lebhaft an die Katholische Zeit, ebenso sind mehrere bei Seite gesetzte Holzschnitzereien, eine Maria-Magdalenen-Figur und eine Truhe als Erinnerungen an jene Zeit zu betrachten. Eine Treppe führt auf die kleine schon recht alte Orgel, die aber noch immer beim Gottesdienst in Activität tritt, und steigen wir eine weitere Treppe nach oben, so gelangen wir auf den Kirchturm Hier hängen zwei Glocken, jede etwa einen Meter hoch und ich bin nicht wenig überrascht als ich mit Hülfe meines freundlichen jugendlichen Führers die Inschrift an den Glocken feststellte. Auf der einen Seite stand folgende lateinische Schrift:
„Homines vos Convoco, Audite, Venite ut adoretis deum ter Optimum maximum.“ Zu Deutsch: „Menschen, ich rufe Euch zusammen, hört und kommt um anzubeten den dreifach besten und größten Gott“. Und auf der anderen Seite: „In Lübeck 1817 gegossen von I. C. W. Landre“. Eine Petrusfigur mit Schlüssel deutet darauf, dass die Kirche dem Apostel Petrus geweiht war.
Auf der zweiten Glocke ist zu lesen: „Diese wie die große Glocke, die am 25. Juli 1816 durch das von einem Gewitter entstandene Feuer zerstört worden ist, ist auf Anordnung des Pastors Herrn Joh. Math. Haefner und der Kirchenjurathen Asm. Saedemund von Kählstorff, Joh. Dohrendorff von Göldenitz, Joh. Friedr. Höppner von Gr. Berkenthien, Hans Friedr Kaths von Düchelsdorf, 1817 durchHerr Joh. Georg Wilh. Landre zu Lübeck umgegossen worden“. Auf der entgegengesetzten Seite steht zu lesen: „Gott lasse sie nie durch Unfall wieder zerstört und lange zu seiner Ehre gebraucht werden.“ ….

Nachdem ich noch einen Blick in die Helmspitze geworfen, in deren Inneres Eulen hausen und durch die geöffneten Turmluken die herrliche Fernsicht auf Feld und Wald und die weit hinten am Horizont sichtbaren Türme von Lübeck genossen, begann der Abstieg. Auf dem Erdboden angelangt, wurde ich noch auf die an die Außenseite der Kirche angelehnte Gruft der Rondeshagener Gutsherrschaft aufmerksam gemacht, aus der man durch eine Spalte im Mauerwerk die altertümlichen wohlerhaltenen Särge erblicken konnte. Ja, wenn die alten Herren von Rondeshagen heute … aus ihrer Gruft auf dem Kirchberge aufstünden, sie würden schöne Augen machen, wenn sie sähen, wie jenseits überm Tal ihrem stillen Kirchlein gegenüber die Eisenbahn auf hohem Damm vorbeirollt. Mit der örtlichen Ruhe ist es dahin, sowie der Schienenweg vorüberführt.“ (Lübecker Vaterländische Blätter 35)