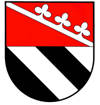Während die Ereignisse rund den Beginn des Zweiten Weltkrieges in einer Vielzahl von Veröffentlichungen dargestellt wurden, liefert die Chronik der Kirchengemeinde Berkenthin einen ergänzenden und anschaulichen Eindruck von den Ereignissen dieser schicksalshaften Zeit in unserem Ort. Offensichtlich war sich der derzeitige Pastor Blunk der Bedeutung jener Tage bewusst, als er 1939 damit begann, über die Geschehnisse und die Stimmungslage der Menschen im Ort eingehend und in eher ungewohnter Dichte zu schreiben. Zunächst spielte sich dabei das Geschehen für die Zuhause-Gebliebenen in weit entfernten Regionen ab, man erfuhr von ihnen lediglich über die gleichgeschalteten Medien, über Zeitungen, Rundfunk und die „Deutsche Wochenschau“, die in den Kinos des nationalsozialistischen Deutschen Reiches gezeigt wurden. Sie wurde in der Regel zwischen dem Kulturfilm und dem eigentlichen Hauptfilm gezeigt und diente gleichzeitig der Information über das aktuelle Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg und auch der Verbreitung von nationalsozialistischer Propaganda. Trotzdem war man auch hier von Beginn an unmittelbar beteiligt, hatte doch bald schon jede Berkenthiner Familie einen Vater, einen Sohn, Bruder oder sonstigen Verwandten an der Front. Doch schließlich rückte das Kriegsgeschehen immer näher, wurde unmittelbar erlebbar. Zunächst in Form sich häufender Bomberüberflüge, der Bombardements der Städte Lübeck und Hamburg, dem Eintreffen der Ausgebombten und schließlich dem Durchzug nicht enden wollender Flüchtlingstrecks aus dem deutschen Osten im Winter 1944/45. Und schließlich hatte der Krieg im Mai 1945 mit dem Einmarsch der Engländer unseren Ort erreicht, bevor dann der böse Spuk ein Ende hatte. Pastor Blunk, vor allem anfangs nicht frei von dem Pathos der NS-Propaganda, berichtet in der Kirchenchronik von den großen Kriegsereignissen, aber auch von dem alltäglichen Geschehen in unserem Ort und berichtet auch immer wieder seismografisch genau über die Stimmung in der Bevölkerung. Er wird damit zu einem ganz wichtigen Zeugen seiner Zeit.
Der Krieg wirft seine Schatten voraus
1939 schrieb der Pastor zunächst über die weltpolitische Lage, die zum Ausbruch des Krieges führte. Dabei schreib er zunächst noch ganz in der offiziellen Diktion der deutschen Reichsregierung, dass ein weiterer Waffengang im Sommer 1939 unmittelbar bevorzustehen und ein Feldzug gegen Polen unausweichlich schien. Seit Juli, vor allem aber in der zweiten Augusthälfte wurden in Berkenthin Reservisten einberufen. Auch konnte man beobachten, wie immer wieder voll beladene Militärzüge über den Bahndamm und die Eisenbahnbrücke in Richtung Osten rollten. Dennoch blieb die Stimmung in der Bevölkerung ruhig, so die Wahrnehmung des Pastors. Man vertraute darauf, dass der Krieg gegen Polen ähnlich unblutig ablaufen würde, wie vor einem Jahr die Zerschlagung der Tschechoslowakei. 1938 hatte Hitler die Wehrmacht in die von vielen Deutschen bewohnten Sudetengebiete einmarschieren lassen, sie „heim ins Reich geholt“, nachdem er sich vorher mit den Garantiemächten des Versailler Vertrages Frankreich, Großbritannien im Münchener Abkommen darauf verständigt hatte. Die ehemaligen Alliierten hatten dem Einmarsch zugestimmt unter der Bedingung, dass Hitler keine weiteren territorialen Forderungen mehr erheben würde. Wenige Wochen später hatten dann deutschen Soldaten unter Missachtung des Münchener Abkommens auch die restliche Tschechei zerschlagen. Nun also Polen. Einige besorgte Berkenthiner erwarteten aber doch heftigeren Widerstand der Polen als in den beruhigenden offiziellen beruhigenden Erklärungen in Aussicht gestellt wurde. Unsicherheit bestand auch darin, wie sich wohl Russland im Falle eines Krieges mit Polen verhalten würde. Diese Anspannung löste sich dann allerdings, als Ende August bekannt wurde, dass sich Russland neutral verhalten würde. Dies war ein Ergebnis des am 23. August unterzeichneten Deutsch-Sowjetischen-Nichtangriffspaktes, der von den beiden Außenminister Ribbentrop und Molotow in Moskau ausgehandelt worden war und das Schicksal Polens besiegelte. Ein geheimes Zusatzabkommen, das erst nach dem Krieg bekannt wurde, beinhaltete darüber hinaus die Aufteilung Polens zwischen den beiden Diktatoren Hitler und Stalin. Unmut und eine gewisse Befürchtung unter der Bevölkerung Berkenthins entstanden lediglich dadurch, dass die Abholung der einberufenen Reservisten stets mitten in der Nacht erfolgte. Allerdings gewöhnte man sich auch daran. Mit Beginn der Kampfhandlungen am 1. September wurden dann der Elbe-Trave-Kanal, wie er damals noch oft genannt wurde, „militärische besetzt“, das heißt nachts standen Wachposten, die von der Gemeinde gestellt wurden, an den Brücken und an der Schleuse.
Besorgnis, aber keine Kriegsbegeisterung
Kriegsbegeisterung, wie noch verbreitet 1914, gab es in Berkenthin keine, wie Pastor Blunk ausdrücklich feststellte. Als aber die Meldungen über den günstigen Kriegsverlauf im Ort einliefen, stärkte dies doch das Vertrauen in die militärische und politische Führung und den „Führer und Reichskanzler“ Hitler. Breites Aufatmen machte sich dann nach dem siegreichen Ende des Feldzuges überall bemerkbar. Sorge bereitete einigen jedoch die Kriegserklärung Frankreichs und Großbritanniens. Aber im Herbst 1939 waren die Menschen hier auf dem Land infolge des Arbeitskräftemangels inzwischen von der Bewältigung der Ernte derartig in Anspruch genommen, dass kaum Zeit zum „Grübeln und Diskutieren“ blieb. Herbst und Winter des Jahres verliefen dann ohne weitere Ereignisse. Die Bevölkerung, so Pastor Blunk, gewöhnte sich schnell an die nun geltenden Verdunkelungsvorschriften und die Rationierung der Lebensmittel- und der Kleidungszuteilung, was aber hier auf dem Land anfangs kaum zu spürbarem Mangel geführt haben dürfte.
Das zweite Kriegsjahr 1940 begann mit einer ungewöhnlich langen harten Kälteperiode. Von Mitte Januar bis in den März hinein hatte der Winter Berkenthin mit Temperaturen bis zu minus 30 Grad ununterbrochen fest im Griff. Wegen der anhaltenden Kälte aber auch wegen des Mangels an Feuerungsmaterial mussten die Gottesdienste in den Konfirmandensaal verlegt werden. Kirchenvertreter Wilhlem Erdmann aus Klein Berkenthin holte dazu das Gestühl aus der Friedhofskapelle in das Pastorat und ein Schreibtisch wurde zu einem behelfsmäßigen Altar hergerichtet. Aber oft war die Kälte so stark und die Wege waren derart verschneit, dass die Bewohner der Außendörfer nicht in den Kirchort kommen konnten, so dass sich meist nur eine kleine Gemeinde zum Gottesdienst einfand. Der Konfirmandenunterricht, Bibelstunden, Kindergottesdienste, aber auch die Zusammenkünfte des Jungmädelbundes und des Posaunenchores mussten oft ganz ausfallen. Mit der Kälte befiel eine schwere Grippeepidemie den Ort, der einige Gemeindemitglieder zum Opfer fielen. Viel Berkenthiner fühlten sich an Kriegsgrippewellen des 1. Weltkrieges erinnert. Erst am 10. März konnte zum ersten Mal wieder ein Gottesdienst in der Kirche abgehalten werden.
Die Monate April brachten dann in rascher Folge eine Fortsetzung des Krieges mit siegreichen Feldzügen in Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien und Frankreich. Nach dem unerwartet schnellen Sieg gegen den alten Erzfeind Frankreich wurden dann an acht Tagen nacheinander mittags die Berkenthiner Kirchenglocken geläutet und an elf Tagen wehte die Hakenkreuzfahne vom Kirchturm.
Gefallen auf dem „Felde der Ehre“
Nachdem der Krieg 1939 abgesehen von einem jungen Soldaten, der an einer Krankheit in einem Lübecker Lazarett gestorben war, keine Berkenthiner Opfer gefordert hatte, fiel „am 10 Juni 1940 (…) das erste Glied unserer Gemeinde auf dem Felde der Ehre“, wie Pastor Blunk im Pathos dieser Tage in der Chronik formulierte. Diesem ersten Kriegstoten folgten in den folgenden Monaten und Jahren viele andere. Die Chronik füllt sich in wachsender Dichte mit den Gefallenenmeldungen von den verschiedenen Fronten. Der Überbringer dieser schlimmen Nachrichten zu den Angehörigen war der hiesige Ortsgruppenleiter der NSDAP Peter Lipp. Zeitzeugen berichteten, dass es ein schlimmes Ohmen war, Ortsgruppenleiter Lipp in Uniform in den Straßen des Ortes zu begegnen, weil klar war, dass er dann meist eine schlechte Botschaft für eine Familie im Gepäck hatte. Pastor Blunk hat alle diese Toten vor dem gänzlichen Vergessen bewahrt und ihnen somit ein bleibendes Denkmal gesetzt, indem er ihr Leben und Sterben in der Chronik jeweils ausführlich dokumentierte. Dabei tun sich dem Leser heute noch zum Teil erschütternde Lebensläufe auf.
Das erste Berkenthiner Opfer des Hitlerschen Angriffskrieges war der Landwirt Friedrich Hans Johannes W. aus Kählstorf. Er war 1914 in Kählstorf geboren und war das älteste unter acht Geschwistern. Er selbst hatte seinen Vater mit acht Jahren verloren und hinterließ u.a. „seine schwer leidgeprüfte Mutter“. Er war 1936 zum Wehrdienst eingezogen worden und war bis 1938 in einem Reiterregiment ausgebildet worden. Bei Ausbruch des Krieges war er im Westen als Reservist eingesetzt worden, wo er als Gefreiter der Infanterie diente. Er galt als ernster und religiöser Mensch und wird sich über die Sinnhaftigkeit dieses Krieges seine Gedanken gemacht haben. In einem letzten Brief schrieb er, dass er gewaltige Märsche durch Belgien absolviert habe und nun bei der Rückführung eines Gefangenentransportes eingesetzt sei. Wenige Tage später erhielt die Mutter von dem Chefarzt des Lazarettes in Marche in Belgien die Nachricht, dass ihr Sohn mit schwersten Kopfverletzungen am 9. Juni eingeliefert worden sein und am 10. Juni dort gestorben sei. Über weitere Nachforschungen, an denen sich Pastor Blunk beteiligte, erfuhr die Mutter dann später von einem Kameraden, dass er bei einer Schießübung verwundet worden sei und nicht in einem feindlichen Gefecht. Er wurde auf einem Soldatenfriedhof bei Marche beigesetzt.
Die „Heldenehrung„
Im Rahmen eines „Dankgottesdienstes unter Mitwirkung des Posauenchores“ für den gewonnenen Feldzug im Westen am 30. Juni in der Berkenthiner Kirche fand dann zugleich eine Gedenkfeier für Friedrich W. statt. Dazu hatte die Mutter im Namen aller Hinterbliebenen einen Kranz am Altar niedergelegt, der später an einer Seitenwand aufgehängt wurde.
Diese „Heldenehrungen“, wie der Pastor sich nannte, für die gefallenen Soldaten sollten dann in der Folge immer häufiger stattfinden. Insbesondere nach dem Überfall auf die Sowjetunion mehren sich die Gefallenenmeldungen
Das Kriegsjahr 1941 begann ebenfalls mit einer wochenlangen Frostperiode, die wieder von Januar bis in den März hineinreichte. Da in diesem Jahr aber genügend Feuerungsmaterial zur Verfügung stand, konnten die Gottesdienste in diesem Winter in der Kirche abgehalten werden. Allerdings konnten die Kirchenfenster nicht ausreichend verdunkelt werden, so dass die Passionsgottesdienste ausfallenmüssen. Die Bibelstunden, die der Pastor in diesen Jahren noch regelmäßig abhielt, fanden in den Schulen der Außendörfer statt. Der Pastor beklagte einen eher schwachen Besuch der Gottesdienste, erklärte das aber mit der hohen Zahl der Einberufungen und der entsprechend großen Arbeitsbelastung besonders der bäuerlichen Bevölkerung. Auf die große Kälte des Winters folgt in den Sommermonaten Juni und Juli eine langanhaltende Hitzeperiode mit Höchstwerten von bis zu 45 Grad in der Sonne. Aber gerade als das Korn reif wurde, folgte eine Periode nassen und unbeständigen Wetters. Dadurch wurde die Geduld der Bauern auf eine harte Probe gestellt, so Pastor Blunk. Am Ende gelang es aber doch, die Ernte ohne größere Verluste einzufahren.
„Am 22. Juni, einem schönen und sonnigen Sonntag bricht dann der Krieg gegen Russland aus.“ Die Berkenthiner seien sich des Ernstes der Lage bewusst, formuliert Pastor Blunk die Stimmung. Da viele Gemeindemitglieder an der Ostfront stünden, blicke man in viele sorgenvolle Gesichter, so Blunk weiter. Es die die einhellige Meinung gewesen, dass der neue Kriegsschauplatz weitere Opfer fordern würde.
Die beiden ersten Opfer auf diesem neuen Kriegsschauplatz waren der Arbeiter Rudolf P. aus Klein Berkenthin, verheiratet und Vater zweier kleiner Kinder, sowie der Berufssoldat Ernst Otto Rudolf M. aus Groß Weeden. Beide starben am 3. August 1942 irgendwo in Russland. Von nun an folgten die Meldungen von gefallenen Soldaten aus unserem Ort beinahe im Wochenrhythmus. Und schließlich mehrten sich auch die besonders tragischen Berichte von Familien, die nicht nur ein Opfer, sondern gleich mehrere zu beklagen hatten.
Schlimme Erinnerungen an die Konfirmation
Wie die die Jahre zuvor, begann auch 1942 mit einer wochenlangen starken Frostperiode. Wieder war der Kanal wochenlang von einer dicken Eisdecke bedeckt, so dass keine Kohlen und anders Brennmaterial angelandet werden konnten. Wegen des Feuerungsmangels mussten die Gottesdienste wieder in den Konfirmandensaal verlegt werden. Auch später konnten ‚Abendgottesdienste wegen der Verdunkelungspflicht nicht durchgeführt werden.
In diesem Frühjahr wurde mit dem Luftangriff auf Lübeck in der Nacht vom 28. auf den 29. März der Krieg zum ersten Mal unmittelbar erlebbar. Für die Zeitzeugen ist auch in Berkenthin die Erinnerung an den Sonntag Palmarum und damit an den Tag der Konfirmationen geknüpft. So für die verstorbene Berkenthinerin Elfriede L., der dieser Tag bis an ihr Lebensende in schlimmer Erinnerung geblieben ist. Auch sie gehörte zu den Jugendlichen, die Palmarum 1941 konfirmiert werden sollte. Sie erinnert sich an den gewaltigen Feuerschein, der in der Nacht zuvor von ihrem Heimatort aus in Richtung Lübeck zu beobachten war: „Der ganze Himmel war rot und hell erleuchtet!“ Dazu waren das Feuern der Flak und die Detonation der Bomben zu hören. Am kommenden Sonntag bei der Konfirmationsfeiersei dann die Stimmung sehr gedrückt gewesen. Sie erinnert sich an eine Tante, die unaufhörlich weinte, weil sie durch den Angriff auf Lübeck ihr ganzes Hab und Gut in Lübeck verloren hatte.

Bemerkenswerter Weise findet dieser erste schwere Luftangriff auf eine deutsche Stadt in den Aufzeichnungen Pastor Blunks keinerlei Erwähnung. Über die Gründe kann man nur spekulieren, möglicherweise waren diese Eindrücke auch für ihn zu gewaltig, als dass er darüber hätte schreiben mögen. Wie auch immer, sicher ist, dass diese Katastrophe in unmittelbarer Nähe auch für viele Berkenthiner das Ende ihrer Hoffnung auf ein schnelles siegreiches Ende des Krieges bedeuten musste. Zum ersten Mal hatten sie direkt die Zerstörung und die Not des Krieges direkt vor Augen. Schwer dürfte das Ereignis auf das Gemüt der Menschen gedrückt haben. Heute weiß man, dass für die britischen Bomber, die aus Richtung Neustadt kamen, beim Anflug auf die Stadt in der Nacht ausgezeichnete Sichtflugbedingungen herrschten. Es schien ein voller Mond bei frostklarer Nacht, so dass die Wasseroberflächen der Trave, des Elbe-Lübeck-Kanals und der Wakenitz rund um die Altstadt das helle Mondlicht reflektierten. Von 23:18 Uhr, dem Beginn des Fliegeralarms, bis zum Ende des Angriffs gegen 2:58 Uhr warfen 234 Vickers Wellington und Stirling Bomber etwa 400 Tonnen Bomben ab. Der Angriff lief in drei Wellen ab. Infolge der geringen Gegenwehr konnten die britischen Bomberbesatzungen aus einer sehr niedrigen Flughöhe von nur 2000 Fuß (etwa 600 m) die Ziele präzise belegen und so sehr große Schäden verursachen.
In der Nacht vom Sonnabend, dem 24. Auf Sonntag, dem 25. Juli 1943 erfolgte der erste der schweren Luftangriffe auf Hamburg. Sie waren Teil der sogenannten Operation „Gomorrah“. Zunächst traf es die westlichen Stadtteile Altona, Eimsbüttel und Hoheluft, die durch Flächenbrände verwüstet wurden .Man konnte von Berkenthin aus an dem großen Feuerschein wie auch an der Heftigkeit des Flakfeuers und der zahlreichen Bombendetonationen die Schwere des Angriffs erkennen. Am Sonntag zog dann eine große schwarze Rauchwolke, die wohl auch aus den getroffenen Öltanks in Hamburg her rührten, über unsere Gegend. Pastor Blunk schreibt, dass sie das Land so sehr verdunkelte, dass man an diesem sonnigen Sommertag bei künstlichem Licht zu Mittag essen musste. Am Nachmittag dieses Tages gegen 17.00 Uhr zogen dann feindliche Bomber, die von Jägern begleitet wurden, auch über unsere Dörfer, während die Flak in Lübeck heftig schoss. In Rondeshagen und in Düchelsdorf gingen feindliche Flieger, die z.T. verwundet wurden und die sich aus ihren getroffenen Flugzeugen hatten retten können, an Fallschirmen nieder und wurden gefangen genommen. Am darauffolgenden Montag erlebte Hamburg weitere Tagesangriffe.
In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli war die Stadt Hamburg dann Ziel des schwersten Angriffes, der alle übertraf, was sich die Menschen bis dahin vorstellen konnten. 739 britische Flugzeuge warfen mehr als 100.000 Spreng- und Brandbomben ab. Der dichte Bombenteppich traf vor allem die dicht besiedelten Arbeiterviertel Hohenfelde, Hamm, Billbrook, Borgfelde, Rothenburgsort, Hammerbrook und das östliche St. Georg. Mehr als 400.000 Menschen hielten sich zum Zeitpunkt dieses Großangriffs in diesem Gebiet auf, etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung. In der Innenstadt brannte die Alstertarnung, ein Netz aus Drahtgeflecht und kleinen Blechplättchen. Eine Fläche von 250.000 Quadratmetern stand in Flammen. Am Mittag des 28. Juli wurden alle Hamburger von ihren beruflichen und sonstigen Verpflichtungen entbunden und es wurde ihnen freigestellt, auf eigene Verantwortung zu handeln, um sich zu retten. Es wurde sogar die Erlaubnis erteilt, die Stadt zu verlassen. Bereits am 28. Juli kamen daraufhin die ersten Bombenflüchtlinge auf und in Autos durch Berkenthin. Kraftwagen an Kraftwagen schob sich über die Landstraßen und durch den Ort. Für Pastor Blunk und die Einwohner damals ein vollkommen ungewohnter Anblick, da man auf den Straßen des Dorfes seit vier Jahren fast keine Fahrzeuge mehr gesehen hatte. Blunk berichtet weiter: „ Zugleich ein Bild des Elends und des Jammers: Auf Lastwagen die Menschen dicht gedrängt, mit dem Ausdruck des Grauens auf den übernächtigsten Gesichtern, mit dem wenigen Habseligkeiten, die sie gerettet hatten.“ Während die meisten Fahrzeuge in Richtung Ratzeburg weiterfuhren, blieb ein Lastwagen mit Bombenflüchtlingen in Berkenthin. Er war zuvor von dem Bruder des Pastors, dem Staatsanwalt Otto Blunk, gezielt in unseren Ort geleitet worden, wo dann die Ausgebombten von dem Bürgermeister in Privatquartieren untergebracht wurden. Zum ersten Mal erfuhren die Berkenthiner nun aus den Erzählungen von dem unerhörten Ausmaß der Zerstörung in Hamburg.
Doch schon in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli erfolgte der nächste schwere Angriff. Wieder lag am folgenden Tag eine unheimliche schwarze Wolke über dem Land und der Zug der Flüchtlinge wurde immer größer. Die Chronik berichtet nun auch von „beängstigend überfüllten Zügen“, die nun über die Eisenbahnbrücke in Richtung Osten rollten. Die Menschen standen demnach sogar auf den Trittbrettern. Auf den Bahnhöfen wurden an die Durchfahrenden Wasser, Fruchtsäfte und frischer Milch ausgegeben. Für die Flüchtlinge, die in Berkenthin untergebracht werden sollten, wurde in Erdmanns Gaststätte eine erste Sammelstelle eingerichtet. Hier wurden dieses Menschen, die zum Teil seit Tagen keine Nahrung bekommen hatten und völlig entkräftet waren, von dem weiblichen Reichsarbeitsdienst und der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt verpflegt. Pastor Blunk hob in seinem Bericht die gute Organisation durch Bürgermeister Heinrich Schwarz sowie die disziplinierte Haltung der Bombenopfer hervor.
Einen Eindruck von der bedrückenden Stimmung dieser Tage vermittelt dann besonders der Bericht eines weiteren Luftangriffs auf die Hansestadt in der Nacht vom 2. auf den 3. August. In dieser Nacht tobte laut Kirchenchronik zu allem Unglück über Berkenthin ein furchtbares Gewitter, während zur gleichen Zeit der Angriff auf Hamburg und Umgebung erfolgte. In das Krachen des Donners mischte sich nun das Schießen der Flak und das Einschlagen der Bomben, berichtet Pastor Blunk. Und wieder war ein breiter Feuererschein am Himmel zu sehen, der durch das Zucken der Blitze gespenstisch aufgehellt wurde. Und Pastor Blunk schreibt, dass diese Nacht sogar in seiner Gemeinde zumindest indirekt ein Todesopfer gefordert habe. Am Tag darauf hatte sich eine Flüchtlingsfrau aus Hamburg, die an den Tagen vorher mit ihrer Familie in Sierksrade untergekommen war, in einem „Anfall von Schwermut, weil die Nacht vom 2. auf den 3. August so niederdrückend auf sie gewirkt (habe)“, so der Pastor, das Leben genommen.
Feindflug mit dem Ziel Berlin
Am 24. Mai 1944 stürzte in der Kanalniederung unweit von Hollenbek ein amerikanischer Bomber ab. Was sich an diesem Tag genau zugetragen hat, erfahren wir aus einem Bericht eines Mitgliedes der Bomberbesatzung, den der Arbeitskreis Geschichte des Amtes Segeberg Land in ihrer Dokumentensammlung „Straße der Bomber“ veröffentlicht hat. Die Autoren dieser Schrift hatten sich vor einigen Jahren daran gemacht, die Geschichte der Fliegerabstürze während des zweiten Weltkrieges im südlichen Holstein aufzuarbeiten. Im Zuge ihrer Recherchen werteten sie deutsche Akten aus und stießen außerdem auf den Bericht eines überlebenden Mitgliedes jener Bomberbesatzung, die über Berkenthin abgeschossen wurde. Vor allem auf den Zeitzeugenbericht dieses MG-Schützen Sergeant (Sgt.) John Legg stützt sich die folgende Darstellung. Demnach befand sich die Maschine vom Typ Boing 17 (B 17) an jenem Morgen des 24. Mai auf einem Feindflug mit dem Ziel Berlin. Sie gehörten zur 349. Schwadron der 100. Bombergruppe der US Airforce, die in Thorpe Abbotts nahe der englischen Ostküste stationiert war. Insgesamt bestand die Crew des Flugzeuges aus 10 Mitgliedern, der Kapitän der Maschine war Lieutenant (Lt.) Jespersen (Bild stehend 2.v.re.), während John Legg (knieend 2.v.re.) selbst als MG-Schütze in der Flugzeugmitte postiert war. Noch am Vortag hatten sie auf dem Rückflug von ihrem letzten Einsatz gegen Troyes in Frankreich gerade noch mit stotternden Motoren die englische Küste erreicht. Ihre reguläre Maschine musste daraufhin repariert und gewartet werden, so dass sie an diesem 24. Mai mit einer fast neuen Maschine mit erst 75 Betriebsstunden unterwegs waren. Sie trug den Namen „“Time´s A Wastin’“, welcher vorne unter der Pilotenkanzel auf den Rumpf geschrieben stand. Für ihren Einsatz gegen Berlin hatte die viermotorige Boing an diesem Morgen zwanzig 300 Pfund Brandbomben an Bord.

Die Maschine und die anderen Maschinen der Schwadron waren bereits beim Überqueren der deutschen Nordseeküste aufgrund schlechter Sicht vom Hauptverband abgekommen, wodurch die gesamte Abteilung zu einem bevorzugten Ziel deutscher Jagdflieger wurde. Die Situation verschlechterte sich noch dadurch, so Überlebender John Legg, dass die erwartete Eskorte durch amerikanische Jagdflugzeuge aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht da war. Legg berichtet dann weiter: „ Als wir die Nordsee verließen und über Land auf Berlin zu flogen, dauerte es nicht lange, dass 25 deutsche Jäger uns entdeckten. Nachdem sie uns zur Erkundung der Situation umflogen hatten, positionierten sie sich in Linie etwas höher vor uns, um dann einen Frontalangriff zu starten, bei dem MG- und Kanonentreffer überall einschlugen. Jespersen ging in den Sturzflug über, als er das Flugzeug abfing, stürzte eine unserer B 17 in Flammen senkrecht an uns vorbei dem Boden zu, uns nur ganz knapp verfehlend. Unser Kinnturm (Waffenturm direkt unterhalb des Bugs) und der Bodenturm (Waffenturm an der Flugzeugunterseite) waren verstummt und in dem Nr. 2 Motor war ein großes Loch. Drei unserer Flugzeuge gingen in Minuten zu Boden, während unsere Maschine noch flog und alle Jäger jetzt hinter uns her waren. Ein Geschosssplitter hatte meinen Helm durchschlagen, aber ich verspürte keine Schmerzen. Während des Angriffs war auch mein Sprechfunk mit dem Rest der Mannschaft ausgefallen. Wir überlebten den ersten Angriff, weil der Pilot in den Sturzflug überging. Als wir danach zu steigen versuchten, um die übrig gebliebenen B-17 zu erreichen, machten die feindlichen Jäger eine Wendung und griffen erneut an, jetzt von hinten. Ihre 20 mm Geschosse explodierten überall und das Flugzeug vibrierte unter den Einschlägen. Das Geräusch und die Blitze der explodierenden Geschosse und das Brechen und Verbiegen von Metall waren furchtbar.“
Absturz
Den dramatischen Absturz erlebte Sgt. Cregg dann folgendermaßen: „Jetzt kamen Feuerströme aus dem Motor Nr. 2 und fast augenblicklich stand auch der zweite Motor in Flammen. Jahre später erfuhr ich, dass Jespersen in diesem Moment den Befehl zum Aussteigen gab, aber wegen meiner nicht funktionierenden Sprechanlage hörte ich das nicht. Ich wusste nicht, dass der Copilot Bob Atkins und der Ingenieur George Kostoulakis in 15.000 Fuß Höhe ausgestiegen waren. Der Pilot, der Bombenschütze und der Navigator bereiteten sich darauf vor, ebenfalls auszusteigen, als der Vorderteil des Bombers heftig explodierte. Dadurch wurden Jespersen, der Pilot, und Joe Savino, der Bombenschütze, aus dem Flugzeug geschleudert. Wir denken, dass Beryk Seely, der Navigator, irgendwie in das Wrack zurück geschleudert wurde. Ich glaube, dass zu dieser Zeit Teile der Tragflächen und Frontpartieteile schon verschwunden waren. Der Rumpf fiel und wir fünf übrig gebliebenen Mannschaftsmitglieder waren immer noch in dem Rest, der von unserem Flugzeug übrig geblieben war. Langsam nach unten kippend, aber immer noch in einer stabilen Position, bewegten wir uns, fast sensationell, schwebend in der Luft.“ Schließlich gelang es John Legg, nachdem er sich noch um einen sterbenden Kameraden gekümmert hatte, in dem Chaos des abstürzenden Flugzeuges seinen Fallschirm anzulegen. Wörtlich berichtet er weiter: „Dann setzte ich meine Füße auf den Lukenrand, sprang durch die offene Luke und sah, dass der Boden offensichtlich sehr schnell näher kam. Ich glaube, dass die Höhe nur noch 1.000 Fuß war. Im Herausspringen zog ich sofort die Reißleine und fühlte das Öffnen des Schirms. Ich sah, wie das Flugzeug die Erde erreichte, explodierte und in kurzer Entfernung von mir zu brennen anfing. Nach einigem Hin- und Herschwingen stürzten mein Schirm und ich in einen Baum und ich baumelte in 15 Fuß Höhe über dem Erdboden. Da ich wusste, dass ich meinen Schirm nicht aus dem Baum würde befreien können, verschwand mein Gedanke an ein Verstecken. Während des Hängens in dem Baum bemerkte ich, dass mir mein Hinterteil weh tat und dass mein Kopf blutete. Ich zog einen kleinen Ast an mich heran und konnte so nach einigen Versuchen einen größeren Ast in den Griff bekommen. Danach konnte ich ein Bein über den Ast schwingen, mich von den Gurten befreien und zu Boden springen.“
Anmerkung der Verfasser zm Absturzort:
Wie sich aus dem Bericht und den späteren Aufzeichnungen rekapitulieren lässt, ist die gesamte Frontpartie bereits während des Fluges abgesprengt worden und in der Kanalniederung in der Nähe von Hollenbek niedergegangen. Der Rest der Maschine ist danach in der Nähe der alten Bahnstrecke zwischen Berkenthin und dem Bartelsbusch abgestürzt, was von einheimischen Augenzeugen bestätigt wurde. Hier sind dann auch John Legg und einige seiner Kameraden an ihren Fallschirmen gelandet.
Gefangennahme und Zur-Schau-Stellung auf dem Ratzeburger Markt
„Unmittelbar danach“, setzt er seine Bericht fort, “ wurde ich mit einem Zivilisten konfrontiert, der sein Gewehr direkt auf mich richtete. Er schien aus dem Nichts zu kommen, denn ich hatte niemanden gesehen, als ich in dem Baum landete. Ich nehme an, dass er die Stelle erreichte, als ich beschäftigt war. Er machte mir klar, dass ich mich setzen sollte und ich begann zu überlegen, was alles vor mir liegen würde und ob ich der einzige Überlebende aus unserem Flugzeug sei. Nach kurzer Zeit erreichte uns ein großer schwarzer Wagen mit Chauffeur mit einem deutschen Offizier auf den hinteren Sitzen. Er war offensichtlich erfreut, einen amerikanischen Flieger gefangen nehmen zu können. Er befahl dem Soldaten, der sein Fahrer war, mir alles aus den verschiedenen Taschen meiner Fliegerkleidung zu nehmen. Nach dieser Suche wurde auch meine Erkennungsmarke von meinem Hals genommen, was mich wirklich schockierte. Wenn mir jetzt irgendetwas passieren würde, gäbe es keine ldentifizierung meines Körpers. Danach erhielt ich den Befehl, in den Wagen zu steigen. Als wir die Straße entlang fuhren, dachte ich, Bob Atkins (der Copilot der Maschine, Anm. der Red.) auf einem Hügel zu sehen, nicht weit von der Straße und machte eine Bewegung, ihm zu winken. Das brachte mir einen plötzlichen Schlag auf Nacken und Schulter ein, ausgeführt durch den Offizier hinter mir. Es war, als hätte ein Blitzstrahl mich getroffen. Ich nehme an, dass er den Kolben seiner Pistole benutzt hat. Das hat mich dann veranlasst, mich für den Rest der Fahrt in eine Stadt namens Ratzeburg still und ruhig zu verhalten.
Nach dem Erreichen der belebten Stadtmitte befahl mir der Offizier, auszusteigen und auf den Bürgersteig zu treten. Danach wurde mir befohlen, mich bis auf Schuhe und Socken zu entkleiden. Zivilisten sahen zu und lachten, aber sie kamen nicht sehr nahe an mich heran. Ich hatte noch eine Sprachkarte in meiner Schuhsohle versteckt, die sie bis zu dieser Zeit nicht gefunden hatten. Da nun nichts mehr gefunden wurde, bedeutete er mir, mich wieder anzuziehen. Danach wurde ich zurück in dem Wagen beordert. Kurz danach brachten sie mich zu einem Stadtgefängnis. Dort in der Zelle liegend dachte ich daran, was mir als Kriegsgefangener passieren würde. Ich richtete ein Gebet an Gott.
Später kam jemand, um meine Kopfwunde zu sehen. Ich glaube, sie rasierten einiges Haar weg und brachten eine antiseptische Flüssigkeit auf die Wunde. Dann wickelten man eine Binde vollständig um meinen Kopf. Nun, sehr verwirrt, bekümmert, müde, voll Furcht, realisierend, dass ich ein Gefangener in Deutschland war, nicht wissend, was morgen passieren würde, hatte ich Schwierigkeiten zu schlafen. Am frühen nächsten Morgen wurde ich nach draußen gebracht, um mich mit anderen Gefangenen aufzureihen und dazwischen vier Mitglieder meiner Mannschaft. Sie zu sehen, besserte mein Befinden und ich werde einige Tränen vergossen haben. Obwohl uns nicht erlaubt war zu sprechen, wussten wir, dass fünf unserer zehn Kameraden überlebt hatten. George Kostoulakos war in einem sehr schlechten Zustand.“
Schockierende Eindrücke in Hamburg
Anschließend werden die Gefangenen in einem normalen Personenzug vom Ratzeburger Bahnhof aus zunächst nach Hamburg und dann nach Frankfurt gebracht und von dort aus mit einem Auto in ein Befragungszentrum. In Hamburg nimmt Legg mit Entsetzten eine Stadt in Trümmern wahr, hervorgerufen durch die alliierten Bombardements. Er berichtet weiter: „Als die Bewacher uns (in Hamburg) aus dem Zug in die Bahnhofshalle brachten, kam eine Gruppe von hysterischen und aufgebrachten Zivilsten auf uns zu, mit Knüppeln, Stöcken und Regenschirmen in der Hand. Unsere Wachen richteten ihre Gewehre in Richtung der Gruppe und befahlen ihnen, sich zurückzuziehen, um uns zu beschützen. Einige Zivilisten kamen trotzdem nahe an uns heran und schlugen zwischen den Wachen nach uns, traten und spuckten. Ich sah wirklichen Hass in ihren Augen und ich vermute, jedermann würde sich so verhalten, wenn seine Stadt dauernd bombardiert würde.“
John Legg überlebte die Gefangenschaft und kehrte nach dem Krieg in die USA zurück, wo er danach als Lehrer arbeitete. Wenige Jahre nach diesem Bericht ist er in hohem Alter gestorben.
Anders als von Pastor Blunck dargestellt, der in der Kirchenchronik von neun Besatzungsmitgliedern ausgegangen war, von denen fünf gestorben und vier weitere gefangengenommen worden seien, geht aus dem Bericht und aus den deutschen Akten hervor, dass tatsächlich 10 Besatzungsmitglieder an Bord waren, von denen 5 überlebt haben. Die fünf toten Soldaten wurden am 27. Mai 1944 auf dem Vorwerker Friedhof in Lübeck beigesetzt, später dann aber auf amerikanische Soldatenfriedhöfe umgebettet.
Berkenthiner Augenzeugen
Unserer lokaler Historiker Walter Koop, zu dem das Autorenteam im Jahre 2002 Kontakt aufgenommen hatte, hat daraufhin Augenzeugen zu Wort kommen lassen, deren Aussagen auf eigenen Wunsch anonym wiedergegeben wurden. Seinen Angaben zufolge liegt die Absturzstelle am Rande des Bartelsbusch südlich des ehemaligen Bahndamms in der Nähe der Wohlbek.
Aussage 1: „Auf unserem Hof waren sechs Soldaten aus Ratzeburg einquartiert, die einige Wochen das Flugzeug absperrten und bewachten. Als damals 20-jahnges Mädchen durfte ich einmal das Wrack mit zwei deutschen Soldaten davor fotografieren “
2. Aussage: „Als l2-jähriger Sohn eines Berkenthiner Landwirtes und späterer Erbe des Hofes kenne ich die Gemarkung genau. Ich erreichte mit drei Freunden als Erster den Absturzort und kann heute noch präzise die Lage des Flugzeugs bestimmen. In geringer Entfernung von dem Wrack fanden wir drei tote Besatzungsmitglieder auf dem Rücken liegend in einer sumpfigen Niederung. Die drei Soldaten hatten keine Fallschirme angelegt. In 250 m Entfernung sahen wir zwei Fallschirme in den Bäumen eines kleinen Gehölzes hängen. Diese konnten wir aber wegen eines dazwischen verlaufenden Baches nicht erreichen. Über den Zustand, des Schicksal und die Gefangennahme dieser beiden Besatzungsmitglieder kann ich keine Auskunft geben.“
3. Aussage: „Als damals 7 Jahre alter Sohn des Besitzers der Koppel, auf die das Flugzeug abstürzte, fuhr ich in Begleitung eines Erwachsenen am 24.5.1944 von Berkenthin nach Ratzeburg. Mit anderen Fahrgästen sah ich aus dem fahrenden Zug heraus am Bahndamm drei Soldaten, die ich für Engländer gehalten habe.“
4. Aussage: „Als damals 17-jähriges Mädchen erreichte ich das Flugzeugwrack einige Zeit nach dem Absturz. Meiner Meinung nach konnte ich erkennen, dass sich ein offenbar totes Besatzungsmitglied in einer offenen Luke des Flugzeugs befand. Kurze Zeit später wurde die Unglücksstelle von deutschen Soldaten der im Ort befindlichen Brückenwache abgesperrt.“
5. Aussage: „Ein Flugzeugmotor und einige weitere Wrackteile lagen auf unserer neben der Absturzstelle liegenden Koppel. Nach Aufhebung der Absperrungen erlaubte mein Mann, dass die bei uns wohnende Flüchtlingsfamilie diese Teile bergen und verkaufen konnte.“
Nach Abgleich der vorhandenen Unterlagen und der Zeugenaussagen ergab sich für die Verfasser des o.a. Beitrages „Die Straße der Bomber“ folgende Zuordnung: Demnach war der Überlebende John Legg einer der abgesprungenen Amerikaner, dessen Fallschirm an einem Baum hängen geblieben war. Er hatte wahrscheinlich nicht bemerkt, dass einer seiner Kameraden ebenfalls mit seinem Fallschirm in einem Baum gelandet war. Bei den drei Toten ohne Fallschirm an dem Flugzeugrumpf wird es sich demzufolge um den schon während des Luftkampfes gefallenen Heckschützen Ssgt. John Durrenberger, (31.10.1914 Princeton) den in seinem Bodenturm eingeklemmten Schützen Ssgt. Frank Fisher (*21.9.1920 New York) und den in panischer Angst in seinem Radioraum verbliebenen Funker Sgt. Frank J. Gronkowski ( * 19.9.1919 Buffalo) gehandelt haben (Aussage 2). Bei den am Bahndamm gesehenen drei Besatzungsmitgliedern dürfte es sich um den Copilot 2nd.Lt. Robert T. Atkins, den Bombenschützen 2nd.Lt. Josef Savino und den Bordingenieur und Rückenturmschützen Sgt. George Kostoulakis gehandelt haben (Aussage 3). Der von einem Mädchen in einer offenen Flugzeugluke hängend gesehene Tote war demnach der rechte MG-Schütze Ssgt. Thomas Kiriako (* 23.2.1923 Maine)(Aussage 4). Der Navigator 2nd.Lt. Burton Seely ist als verbliebenes 10. Mitglied der Besatzung zusammen mit dem Flugzeugrumpf zu Boden gestürzt und in dem dort ausgebrochenen Feuer offensichtlich bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er war der Zeitzeugenaussage zufolge nach der Explosion in dem abstürzenden Flugzeug in den Rumpf zurückgeschleudert worden.
Quellen: Der Bericht über den Flugzeugabsturz basiert auf der Dokumentation „Die Straße der Bomber. Flugplätze, Fliegerangriffe, Luftkämpfe und Flugzeugabstürze während des 2. Weltkrieges im Kreis Segeberg und Umgebung“ des Arbeitskreises Geschichte im Amt Segeberg Land, ISBN 3980495981, das Foto der Besatzung wurde ebenfalls dieser Dokumentation entnommen. Der Originaluntersuchungsbericht der US Air Force findet sich im US National Archive https://catalog.archives.gov/id/90976049?objectPage=6.
Ergänzt wurde die Darstellung durch ein unveröffentlichtes Manuskript Walter Koops.
Der Krieg rückte nun auch für Berkenthiner in jeglicher Hinsicht immer näher. Die Zahl der gefallenen Soldaten nahm zu, in immer kürzeren Abständen berichtet der Pastor nun von gefallenen Gemeindemitgliedern. Und immer häufiger traf es Familien, die zum wiederholten Male Opfer zu beklagen hatten: den Sohn, den Vater, den Bruder. An die Gottesdienste schließen sich nun von Woche zu Woche sogenannte Heldenehrungen, meist unter großer Beteiligung der Gemeinde und oft unter Mitwirkung des Posaunenchores, wie der Pastor immer wieder feststellt.
Auch überflogen nun immer häufiger Bomberverbände die Region, um ihre Bombenfracht über den östlicher gelegenen Städten abzuladen. Am 24. Mai 1944 wurde, während ein starker feindlicher Fliegerverband unsere Gegend überflog, über der Groß Berkenthiner Feldmark in der Nähe vom Bartelsbusch ein amerikanischer Bomber abgeschossen. Von den neun Besatzungsmitgliedern waren fünf tot, während die vier übrigen gefangengenommen wurden.
Inzwischen hatte sich die Kriegslage an allen Fronten längst entscheidend zu Ungunsten Deutschlands geändert. Im Sommer 1944 waren die Westalliierten in der Normandie gelandet und im Osten drängte die Rote Armee gegen die Reichshauptstadt Berlin. Seit Ende 1944 stand sie auf deutschem Boden und Januar 1945 begannen die Sowjets aus dem Weichselbrückenkopf bei Baranów mit der breit angelegten Weichsel-Oder-Operation und weiter südlich mit der Westkarpatischen Operation. Das Schicksal der Menschen, die vor dem Krieg ihre Heimat verlassen mussten und gen Westen flohen ist in unzähligen Publikationen beschrieben. Der Weg nach Schleswig-Holstein führte dabei viele Trecks aus den östlichen Provinzen über Ratzeburg weiter über die Landstraße durch Berkenthin weiter ins Landesinerre, bevor sie auf die einzelnen Ortschaften im Land verteilt wurden. So schreib dann auch Pastor Blunk, dass seit der zweiten Hälfte des Monats Februar des Jahres 1945 täglich Flüchtlingstrecks aus dem Osten durch den Ort zogen. Die Verpflegung der Trecks, die auf dem Durchzug waren, erfolgte in der Regel bei Gastwirt Erdmann und im Reichsarbeitsdienstlager (RAD Lager). Die Pferde wurden dann für eine oder wenige Nächte bei den Bauern untergestellt, während die Flüchtlinge am Anfang im Schulraum oder bei Erdmann auf dem Saal übernachteten. Die Chronik vergleicht den Hof vor Erdmanns Gasthof mit einer „einzigen Lagerstätte“. Und: „Die Pferde sind z.T. sehr erschöpft (…) und die Menschen machen vielfach der infolge des unerhörten Leidens und der Strapazen einen stumpfen und dumpfen Eindruck.“ Viele dieser ersten Flüchtlinge stammten ursprünglich aus Bessarabien, der Ukraine und anderen unter sowjetischer Herrschaft gestandenen Gebieten. Während des Krieges waren sie u.a. in das Warthegau und nach Westpreußen umgesiedelt worden. In diesen Tagen wurden auch die ersten Flüchtlingsfamlien direkt in Berkenthin untergebracht.
Vermehrt wurden nun auch Ziele in Berkenthin und Umgebung von Tieffliegern angegriffen. Am 28. Februar wurde sogar das Pastorat direkt von einem Tiefflieger mit Feuer belegt, der es eigentlich auf die Schleuse und die im Kanal liegenden Schiffe abgesehen hatte. Allerdings wurden nur einige Bäume im Pastoratsgarten von dem MG-Feuer getroffen.
Danach wurden die Flüchtlingstrecks immer größer. Tag um Tag war die Landstraße von Ratzeburg nach Berkenthin von Trecks bedeckt. Vom 16. März 1945 an wurde unser Ort dann für die Flüchtlinge endgültig zur Verpflegungs- und Übernachtungsstation. Es wurden täglich Tausende verpflegt und untergebracht. Am 23. und 24. März war die Zahl der Flüchtlinge im Ort auf 7000 bis 8000 angeschwollen, schätze Pastor Blunk, nachdem die Zahl bereits an den Vortragen bei jeweils 4000 bis 5000 gelegen habe. Die Unterbringung der Flüchtlinge und der Pferde bereitete immer mehr Probleme. Da das Wetter aber inzwischen warm geworden war, kampierten manche Familien im Freien bei und in ihren Wagen.
Wie alle anderen Gebäude war auch das Pastorat mit Flüchtlingen belegt worden. Pastor Blunk notierte beispielsweise für die Woche vom 18. Bis zum 25. März akkurat die Zahl der Menschen, die hier im Konfirmandensaal und anderen Räumen des Gebäudes untergebracht waren.
Sonntag, 18. März: 25 Personen
Montag, 19. März 37 Personen
Dienstag, 20. März 37 Personen
Mittwoch, 21. März 55 Personen
Donnerstag, 22. März 90 Personen
Freitag, 23. März 40 Personen
Sonnabend, 24. März 40 Personen
Sonntag, 25. März 35 Personen
Die Verpflegung der im Ort untergebrachten Personen erfolgte von der Schule aus, wo eine sogenannte „Massenverpflegung“ eingerichtet war. Jedoch wurde von vielen Frauen auch in den jeweiligen Unterkünften selbst gekocht.
Einen bedrückenden Eindruck von dem Elend und dem Durcheinander jener Tage vermittelt auch folgende Episode, von der die Chronik berichtet: Am Abend des 21. März wurde eine sterbende alte Flüchtlingsfrau aus Masuren in den Konfirmandensaal gebracht. Aber noch bevor der Pastor nach ihr sehen konnte, war sie den Strapazen der Vertreibung und der Flucht bei eisigen Temperaturen erlegen. Sie war seit dem 21. Januar auf der Flucht vor der anrückenden Roten Armee gewesen und hatte in diesen letzten Wochen offensichtlich Entsetzliches erlitten. Sie starb im Konfirmandensaal direkt unter dem an der Wand hängenden Kreuz. Da ihr Treck noch am nächsten Tag weiterziehen sollte, ein Sarg aber nicht so schnell beschafft werden konnte, sollte eine kirchliche Trauerfeier auf Bitten der Tochter gleich am folgenden Tag auf dem Friedhof stattfinden. In der Nacht war die Tote in dem dortigen Geräteschuppen aufgebahrt worden. Als der Pastor am kommenden Morgen dort eintraf, um die Trauerfeier zu halten, fand er zu seiner Verwunderung noch eine weitere dort aufgebahrte Leiche. Es handelte sich um einen 71 jährigen Mann aus Pommern, der am frühen Morgen des 22. März in Erdmanns Gasthof gestorben war. So fand auch gleich für ihn die Trauerfeier mit statt, da auch seine Angehörigen mit dem Treck weiterziehen mussten. Einen Tag später erfolgte dann auf dem Friedhof die eigentliche Beerdigung.
Neben diesen genannten sterben noch viele weitere Flüchtlinge, vor allem ältere und kranke Leute, die den Anstrengungen der Flucht nicht mehr gewachsen waren. Sie wurden von Pastor Blunk auf dem hiesigen Friedhof beerdigt.
Am 22. März wurden außerdem 6 Jungen, die zu einem anderen pommerschen Treck gehörten, in der Kirche konfirmiert. Der Teck war in Niendorf untergebracht und hatte dort wegen völliger Erschöpfung der Pferde einen Ruhetag bekommen. Dieser wurde dazu genutzt, um die Kinder zu konfirmieren. An dem anschließenden Abendmahlsgottesdienst nahmen außer den frisch Konfirmierten 40 Personen von dem Pommerschen Treck teil, so Pastor Blunk.
Zu all der Not kam am 25. März noch ein tragischer Unglücksfall, der 4 Todesopfer forderte. In einem Flüchtlingstreck aus Christinenberg im Kreis Naugard in Pommern fuhr ein Trecker mit zwei Anhängern. Auf der damals noch stark abschüssigen Straße am Wohlberg kam das Gefährt von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Sowohl der Trecker als auch der nachfolgende Anhänger schlugen um und begruben den Treckerfahrer sowie drei Kinder, die sich auf dem Anhänger befanden, unter sich. Alle waren sofort tot bzw. starben kurz nach dem Unfall.
In der Zeit vom 12. Bis zum 14. April erlebte das mit Flüchtlingen überfüllte Berkenthin noch die Einquartierung von 400 Soldaten einer Nachrichteneinheit, die sich auf dem Marsch von Holland an die Front im Osten befand.
Im April dann mehrten sich auch die Tieffliegerangriffe in Berkenthin und Umgebung. In der Nacht vom 8. Zum 9. April wurden zahlreiche Bomben zwischen Berkenthin und Hollenbeck abgeworfen, die vor allem in der Niendorfer Feldmark niedergingen. Vom 12. April an erlebte der Ort beinahe täglich solche Tieffliegerangriffe, die vor allem die Schleusen und die Kanalschiffe, aber auch die Eisenbahnbrücke und Eisenbahnzüge zum Ziel hatten. Am 17. April kam es im Luftraum direkt über dem Ort zu starken Luftgefechten, in dessen Verlauf mehrere Flugzeuge abgeschossen wurden und zum Teil brennend in der Umgebung abstürzten. Am 18. April wurden bei Luftangriffen auf die Schleuse und den dort liegenden Schiffen zwei Marinesoldaten getötet und mehrere andere zum Teil schwer verwundet. Die Schiffe fuhren nach dem Angriff weiter, ließen aber die Toten in Berkenthin zurück, die später auf dem Friedhof beerdigt wurde. In Kastorf wurde an diesem Tag ein mit Munition beladener Güterzug von Tieffliegern angegriffen und explodierte. Durch das Feuer schmolzen die Gleise und die Schwellen verbrannten. Am Abend desselben Tages erfolgte eine weiterer Angriff auf in Sierksrade und Groß Weeden abgestellte Bahnzüge, die wahrscheinlich auch Munition geladen hatten. Auch hier gab es starke Detonationen und große Rauchentwicklung. Danach war Berkenthin von der Außenwelt abgeschnitten. Es fuhren nun keine Züge mehr und es kam keine Post und keine Zeitungen mehr an. Auch der Fernsprechverkehr wurde aufgehoben, nur Wehrmachtsgespräche und Ortsgespräche wurden noch durchgestellt.
Da man danach über keine verlässlichen Nachrichten mehr verfügte, machten in der Folge immer mehr Gerüchte die Runde. So sollten angeblich erste feindliche Panzerspitzen bereits am 20. April Lauenburg an der Elbe und auch Hamburg erreicht haben. Und immer wieder das Gerücht, die Russen seien auf ihrem Vormarsch zum Kanal.
Vom 20. April an waren die Brücken des Ortes von Posten besetzt und niemand, auch nicht die Einwohner des Dorfes, durften diese ohne Ausweis passieren. In der Zeit vom 20. April bis zum 29. April verging kein Tag und keine Nacht mehr ohne Tieffliegerangriffe, die es immer wieder auf die Schleusen und die Eisenbahnbrücke abgesehen hatten. An der Straße nach Rondeshagen aber auch an der in Klein Berkenthin sah man Bombentrichter. Die Häuser überfüllt mit Flüchtlingen und einquartierten Soldaten. Dazwischen passierten auch immer wieder deutsche Wehrmachtseinheiten den Ort, meist wegen der Tiefflieger in langen Reihen hintereinander laufend. Am 29. April wurde dann letzte Hand an die Sprengladungen an den Brücken gelegt und für die Sprengung vorbereitet. Die Menschen, vor allem in Groß Berkenthin bewegte vor allem die Frage, wer wohl eher da sein werde: die Engländer oder die Russen. Einige Familien saßen schon auf gepackten Koffern, bzw. hatten schon ihre Wagen beladen, um im Ernstfall auf die andere Seite des Kanals zu fliehen. Elfriede L. wusste zu berichten, dass sie zusammen mit anderen jungen Mädchen von ihren Eltern von ihrem Hof in Groß Berkenthin zu Verwandten in Klein Berkenthin gebracht wurde, wo sie das Kriegsende und die Ankunft der Engländer erlebte. Der Pastor schildert die Stimmung in diesen letzten Kriegstagen als „durchweg gedrückt“
Als die Fronten näher rückten, wurden auch im Kreis Herzogtum Lauenburg Vorbereitungen für die erwarteten Kämpfe getroffen. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, hatte noch am 12. April 1945 einen Befehl erlassen, der auch in der „Lauenburgischen Landeszeitung“ veröffentlicht wurde. „Mit allen Mitteln“ sollten jede Stadt und jedes Dorf verteidigt werden: „Jeder für die Verteidigung eines Ortes verantwortliche deutsche Mann, der gegen diese selbstverständliche nationale Pflicht verstößt, verliert Ehre und Leben.“
Für den Jahrgang 1929 der Hitler-Jugend waren zweitägige Lehrgänge abgehalten worden, um die 16-jährigen Jungen im Umgang mit Panzerfäusten auszubilden. An vielen Stellen des Kreises begann der Ausbau von Stellungen, Schützenlöchern und Schützengräben, vielerorts wurden sogenannte „Panzersperren“ aus Baumstämmen errichtet und mit Minen zusätzlich gesichert. Die Brücken über den Elbe-Lübeck-Kanal wurden von Soldaten einer Pioniereinheit für die Sprengung vorbereitet.
All diese Maßnahmen kamen allerdings über die Anfänge nicht hinaus und blieben letztlich völlig wirkungslos. Nachdem die Briten die Elbe am 19. April erreicht hatten, wurde bei Witzeeze ein Generalkommando eingerichtet, das eine improvisierte „Elbverteidigung“ aufzubauen versuchte. Der Zustand der deutschen Truppen war denkbar schlecht. Neben zusammengewürfelten Resten alter Einheiten kamen auch Jugendliche zum Einsatz, die kaum eine militärische Ausbildung erfahren hatten. Die Ausrüstung war unzureichend, an schweren Waffen fehlte es fast ganz.
In den frühen Morgenstunden des 29. April 1945, einem Sonntag, setzten die britischen Truppen nach heftigem Artilleriebeschuss mit gepanzerten Fähren und Schwimmpanzern bei Artlenburg und am Glüsinger Grund über die Elbe und bildeten einen Brückenkopf. Nicht nur unter den beteiligten Einheiten, sondern auch unter der Zivilbevölkerung gab es bei dieser „Operation Enterprise“ zahlreiche Opfer. Schon am Vormittag wurde die Stadt Lauenburg besetzt. Bis zum Sonntagabend konnte der britische Brückenkopf rasch ausgebaut werden, und die Angreifer gingen in Richtung Krüzen, Lütau und Basedow vor, wo ein SS-Panzergrenadier Ausbildungs- und Ersatzbataillon in Stellung lag. Weiter östlich gelang es schottischen Einheiten, am Spätnachmittag des 29. April das Waldstück Stötebrück und das Dorf Basedow selbst einzunehmen.
Nachdem die letzten deutschen Angriffe im Süden des Kreisgebiets gescheitert waren, rückten die britischen Truppen relativ ungehindert weiter vor. Die britischen Panzer konnten durch die völlig unterlegene Truppe nicht weiter aufgehalten werden. Schwarzenbek war schon am 30. April besetzt worden. Nördlich von Büchen wurde bei Müssen und Siebeneichen kleinere Kampfhandlungen registriert, bei Sahms kam es am 1. Mai zu einem letzten Panzergefecht.
Am Morgen des 2. Mai setzten die britischen Truppen zu ihrem Vormarsch auf Lübeck an. Die deutschen Truppen befanden sich in zunehmender Auflösung, sodass es an diesem Tag kaum noch deutschen Widerstand gab. Nur noch kleinere Schießereien mit Handfeuerwaffen ereigneten sich dort, wo die rasch vorrückenden britischen Truppen auf bewaffnete deutsche Einheiten stießen.
Im Raum Mölln rechneten die Briten offenbar mit größerem Widerstand. Dort war in den letzten Kriegstagen noch ein Oberstleutnant aufgetaucht, der als „Kampfkommandant von Mölln“ den dortigen Volkssturm zu Verteidigung der Stadt einsetzen wollte. Der Kommandeur des Volkssturms weigerte sich, seine Leute für diesen Kampf zur Verfügung zu stellen und löste auf eigene Verantwortung die Einheit auf. Durch den couragierten Einsatz einiger Möllner Bürger gelang es, den Kampfkommandanten zu überzeugen, von der geplanten und vorbereiteten Sprengung der Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal abzulassen.
Die Sprengladungen wurden von Pionieren fachmännisch entfernt. Auch die weiteren Kanalbrücken nördlich von Mölln blieben von einer Zerstörung verschont. Am Möllner Wasserturm und am Getreidesilo am Hafen wurden große weiße Fahnen zum Zeichen der Übergabe gehisst. So blieb die Stadt Mölln, in der sich Tausende von Flüchtlingen und rund 5.000 verwundete Soldaten aufhielten, vor Zerstörungen durch den Krieg bewahrt. Die Briten besetzten Mölln und Ratzeburg ohne Kampf und konnten am selben Tag noch bis Lübeck vorrücken. Am 2. Mai 1945 endete für das Herzogtum Lauenburg und für die Hansestadt Lübeck der Zweite Weltkrieg. 5. Mai 8 Uhr kapitulierten schließlich die deutschen Truppen in Nordwestdeutschland.
Wie bereits berichtet, bereitete man sich auch in Berkenthin auf die Ankunft der feindlichen Truppen vor. Dabei werden die meisten inständig darauf gehofft haben, dass die Engländer vor den Russen den Ort erreichen würden. Sicherheitshalber saß man in Groß Berkenthin auf gepackten Koffern bzw. vollbeladenen Wagen, um gegebenenfalls auf die andere Seite des Kanals wechseln zu können. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass der Kanal die neue Demarkationslinie zwischen den zukünftigen Siegermächten sein würde. Zunächst aber waren die Brücken von Posten besetzt, ein Wechsel auf die jeweils andere Seite des Kanals war nicht mehr möglich.
Am Vormittag des 2. Mai hörte man in Berkenthin von verschiedenen Seiten Artillerie und Panzerfeuer. In Richtung Bliestorf wurden Einschläge von Granaten beobachtet. In den Häusern des Dorfes wurde angesagt, dass zumindest die große Eisenbahnbrücke über den Kanal gesprengt werde. Deshalb sollten Fenster, Türen, Schränke der Häuser geöffnet werden, um größere Schäden an den Gebäuden zu vermeiden. Außerdem wurden die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Über die Absicht der Brückensprengung herrschte in allen Teilen der Bevölkerung jedoch größtes Unverständnis. Allen war klar, der Krieg war ohnehin verloren und der Kanal werde die Engländer nicht aufhalten, da sie über genügend Boote, Schwimmpanzer und Brückenlegefahrzeuge verfügten.


Einer der ersten, der die Ankunft der britischen Soldaten beobachtete, war Carl (Calli) Hack, der spätere und vielen noch bekannte Besitzer der Gastwirtschaft in Groß Berkenthin. Calli Hack war im Frühjahr 1945 ein Junge von 9 Jahren. Am Tag, als die Engländer kamen, musste er das Bett hüten. Er hatte die Masern. Trotzdem holte ihn sein Vater aus dem Bett und sorgte dafür, dass er sich anzieht. Denn man wusste ja nicht, was der Tag bringen werde. Also stand Calli auf, holte sich einen Stuhl und setzte sich ans Fenster und erwartete die Engländer.
Als Berkenthiner Junge hatte er an den Tagen zuvor natürlich mitbekommen, dass die Ankunft der Briten unmittelbar bevorsteht. Überall an den großen Straßen so nach Ratzeburg oder in Richtung Sierksrade waren Splittergräben und Schützenlöcher ausgehobenen und an den Brücken waren Sprengladungen angebracht worden, allerdings noch ohne Zünder. Die größte Sorge der Erwachsenen war in diesen Tagen, dass nicht die Engländer, sondern die Russen zuerst kommen würden. So hielt sich auch im Hause Hack lange die Befürchtung, dass der Kanal die neue Demarkationslinie zwischen den Briten der Sowjetarmee darstellen würde. Als nun aber immer deutlicher wurde, dass die Engländer auf Berkenthin zumarschierten, machte sich überall eine gewisse Erleichterung breit. Denn vor den Engländern hatte man in dem großen Bauernhaus mit Gastwirtschaft eigentlich keine Angst, obwohl man sicherlich nicht genau wusste, was einem bevorstand. Denn Vater Friedrich war als Soldat oft mit der Bewachung von gefangenen britischen Soldaten in der Lüneburger Heide befasst gewesen und hatte diese als zivilisierte Menschen erlebt. So konnte er seine Familie beruhigen: „Wenn wie to de Engländer komt, möt wie keen Angst heben! Wi möt uns bloss anstänni benehm.“
Dass sein Vater in diesen letzten Kriegstagen zu Hause war und nicht wie die meisten anderen Väter irgendwo im Krieg, war einem letztendlich glücklichen Umstand zu verdanken. Friedrich Hack war Marinesoldat und geriet im April 1945 bei den Kämpfen um Bremen als Munitionsfahrer in feindliches Artilleriefeuer. Er überlebte schwer verletzt, konnte aber noch seine Einweisung in das Ratzeburger Lazarett durchsetzen. Dazu musste er sich selbstständig von Bremen nach Hamburg durchschlagen, um dann von dort mit einem der letzten noch fahrenden Züge zunächst nach Hause zu gelangen. Von hier aus fuhr er dann am nächsten Tag mit der Pferdekutsche nach Ratzeburg, um sich verarzten zu lassen. Mit bandagiertem rechten Arm und Schulter konnte er aber gleich wieder die Heimreise nach Berkenthin antreten. Calli Hack erinnert sich noch viele Jahre später, wie er an dem Tag der Ankunft seines Vaters mit einem serbischen Fremdarbeiter vor dem Transformatorenhaus in der Nähe seines Elternhauses saß, als dieser plötzlich auf einen sich nähernden Soldaten zeigte und sagte: „Guck mal, da kommt dein Vater!“ Calli Hack brauchte lange, um in dem ausgemergelten, verdreckten und verwundeten Mann seinen Vater zu erkennen. Auf diese Art erlebte Vater Friedrich Hack das Kriegsende zuhause bei seiner Familie.
Also saß Calli an diesem 2. Mai 1945 auf seinem Logenplatz am Fenster des Landgasthofes und erwartete die Engländer. Der Vater hatte dafür gesorgt, dass wie überall ein weißes Tuch als Zeichen der Kapitulation aus einem Fenster wehte.
Die ersten Briten, die er sah , waren zwei schwer bewaffnete Soldaten mit Stahlhelm und Maschinenpistolen im Anschlag, die am frühen Nachmittag aus Richtung Ratzeburg auf dem Gehweg in den Ort marschierten. Sie überquerten die Straße, gingen ein Stück auf dem Gehweg und einer von ihnen blieb einen Moment lang direkt vor dem Gasthof stehen. Viele Jahre später wird sich Calli an diese Situation erinnern. Kurze Zeit später fuhren auch Panzer und Panzerspähwagen durch den Ort. Weitere Soldaten folgten dann auf Lastwagen. Später am Nachmittag kamen Engländer ins Haus an der Ratzeburger Straße und in erstaunlich gutem Deutsch wurde nach Waffen gefragt, die es aber im Hause Hack nicht gab. Danach wurde die Ausgangssperre verhängt. Alle Bewohner mussten an den kommenden Tagen in ihren Häusern bzw. auf ihren Grundstücken bleiben. Weiter geschah an diesem 2. Mai nichts.
An den folgenden Tagen wurde die Familie Hack zusammen mit den einquartierten Flüchtlingsfamilien dann aber aufgefordert, das Haus zu verlassen, wobei der Umgangston seitens der Engländer zwar bestimmt, aber nicht unkorrekt gewesen sein soll. Während man selbst bei Nachbar Meine unterkam, zog eine Kompanie britischer Soldaten in den Gasthof ein. Der Kompanieführer selbst bezog die gute Stube, während im Schankraum die Schreibstube aufgemacht wurde. Im Saal schliefen 25 Soldaten auf einfachen Feldbetten. Nach wenigen Wochen verließ diese Einheit dann Berkenthin und die Hacks konnten in ihr Haus zurück. Allerdings nur für kurze Zeit, denn nur wenige Tage später kam eine neue Einheit und bezog erneut im Landgasthof Quartier. Und wieder mussten die Hacks ihr Haus verlassen.
Während die Erwachsenen in den Sorgen des Alltags gefangen waren, was würde die Zukunft bringen, arrangierte sich der kleine Junge auf seine Weise mit der neuen Situation. Er bekam noch mit, dass ein Hakenkreuz, dass sich ein Nachbar und überzeugter Nationalsozialist in den Giebel seines Hauses hatte mauern lassen, von den Briten mit einem Maschinengewehr aus dem Mauerwerk herausgeschossen wurde. Und er sah andächtig dem Kompanieschuster, der in der Diele seines Elternhauses seinem Handwerk nachging, bei seiner Arbeit zu. Während er die derben Soldatenstiefel neu besohlte und mit Nägeln fixierte, bemerkte er Callis ebenfalls stark ramponierte Schuhe. Er legt sofort die Soldatenstiefel zur Seite, um nun die Schuhe des Jungen ebenfalls mit Schusternägeln zu bearbeiten. Allerdings sehr zum Leidwesen der Eltern, da bald danach die Dielenböden des Hauses eindeutige Kratzspuren aufwiesen.
Derweil ging die Arbeit auf dem Hof weiter, es war Frühjahr und viel Arbeit stand an. Z.B. musste der Dung auf die Felder gebracht werden. Aber Vater Friedrich war aufgrund seiner Kriegsverletzung stark eingeschränkt und auch die Fremdarbeiter drohten ihre Arbeit einzustellen. Der serbische Kriegsgefangene, so erinnert sich Calli Hack, tauchte noch am Tag seiner Befreiung unter. Zwei polnische Gefangene „organisierten“ sich Tage später erst einmal Fahrräder, um sich das zerstörte Lübeck anzusehen. Dennoch gelang es Friedrich Hack, diese beiden wie auch eine ukrainsche Mutter mit ihrem Sohn für einige Zeit zur Weiterarbeit auf dem Bauernhof zu überreden. Zum einen, weil sie auch während des Krieges korrekt behandelt worden waren. Sie hatten stets mit am Familientisch gegessen, was offiziell seitens der deutschen Behörden streng verboten war. Außerdem hatten die Polen in ihrer Kammer ein Fass Butter aus deutschen Wehrmachtsbeständen gesichert, das sie nun gegen andere Lebensmittel umtauschen wollten. Daraufhin habe Vater Friedrich Hack ihnen klargemacht: „ Wenn jöm dat wöllt und wat to eten heben wöllt, denn möt jöm ok wat dorfür don!“ Später wurde dann der Mieter der Altenteilerwohnung, der während des Krieges im Möllner Munitionswerk als Kolonnenführer gearbeitet hatte, als Deputatsarbeiter verpflichtet.
Viele Jahre später, es muss in den 60ern gewesen sein, Calli Hack war längst Gastwirt und Bauer auf dem Hof, beobachtete der Junge von einst, wie vor seiner Wirtschaft ein großer Opel Admiral hielt. Vier Männer im Anzug, offensichtlich Geschäftsleute stiegen aus und betrachteten den Landgasthof. Sie kamen rein, setzen sich und bestellten etwas zu essen: Steak, Bratkartoffeln, Gemüse und tranken ein Bier. Man kam ins Gespräch und einer der Männer fragte den Wirt, ob er bei Kriegsende auch schon hier auf dem Hof gewesen sei. Calli berichtete vom Tag, als die Engländer kamen, und merkte, dass einer der Gäste sehr aufmerksam zuhörte und einen roten Kopf bekam. Es stellte sich heraus, dass er einer der beiden ersten englischen Soldaten in Berkenthin war, und zwar der, der 1945 kurz vor dem Gasthof gehalten hatte. Er war inzwischen erfolgreicher Geschäftsmann geworden und hatte gegenüber seinen deutschen Partnern geäußert, dass er nun das letzte Mal in Deutschland sei. Aber er wolle noch einmal nach Berkenthin, wo er das Kriegsende erlebt habe. Also sei man kurzerhand von Aachen in den Norden gefahren, habe sich in Ratzeburg eingemietet und sei nach Berkenthin gefahren. Die Überraschung war auf allen Seiten riesig ob des unerwarteten Wiedersehens.
Was man im Hause Hack damals nicht wusste, war, dass Ringen das damaligen Bürgermeisters Heinrich Schwarz um den Erhalt der Berkenthiner Brücken. Heinrich Schwarz scheibt in seinen Lebenserinnerungen wie folgt:
„Am 1. Mai kamen die Engländer näher, schon hörte man den Kanonendonner von Lauenburg an der Elbe hochkommen und hier wurden alle Vorbereitungen getroffen, die drei Brücken über den Kanal zu sprengen. Kurz vor dem Einmarsch der Engländer am zweiten Mai bekam ich in der Bürgermeisterei den Befehl: Alle Einwohner des Dorfes hätten sofort ihre Häuser zu verlassen, die Sprengung der Brücken sei befohlen. Durch einen besonderen Zufall konnte ich den kommandierenden(….) Offizier telefonisch erreichen und es gelang mir, dass die Sprengung in letzter Minute aufgehoben wurde. Ein Offizier vom Hauptkommando brachte persönlich den Befehl. Der hiesige Volkssturm hatte unter Anweisung des Sprengkommandos die Bomben mit eingebaut und so konnte sofort mit dem Ausbau begonnen werden. Die Bewohner, soweit sie (überhaupt) ihre Häuser verlassen hatten, konnten wieder zurück ziehen. Was der Bürgermeister als „einen besonderen Zufall“ beschreibt, geht auch aus den Erinnerungen der damaligen Postangestellten und Telefonistin Lotti Schreiter hervor, die ebenfalls einen großen Anteil an der Rettung der Brücken hatte. Ihr Bericht liefert dabei einen sehr lebendigen Eindruck von den Ereignissen jener Tage. „Damals war ich Postangestellte und am Postamt Berkenthin beschäftigt. Das damalige Postgebäude lag direkt an der Fußgängerbrücke die über den Kanal führt.
In der letzten Kriegswoche wurde unser Ort laufend von feindlichen Tieffliegern überflogen und auch angegriffen. Die letzten Tage vor Kriegsende musste ich Tag und Nacht Dienst tun, denn meine Kollegin Elisabeth von Wnuck-Lipinski, die bei der Behlendorfer Schleuse wohnte, konnte wegen der Tieffliegerangriffe nicht mit dem Fahrrad nach Berkenthin kommen, um mich abzulösen. ln der Nacht vom 1. auf den 2. Mai ging es sehr turbulent zu. Da ich Tage und Nächte vorher schon fast kein Auge zugemacht bekam, weil nachts laufend Militärgespräche und am Tage ebenfalls auch Zivilgespräche vermittelt werden mussten. In dieser Nacht musste ich noch die Hebamme Frau Keiss in Kastorf zu einer werdenden Mutter rufen. Morgens um 4.00 Uhr stellte ich das Gespräch nach Kastorf her. Aber die Hebamme sagte, wegen der Tiefflieger könne sie nicht kommen und sie hätte auch Angst alleine mit dem Fahrrad zu fahren. Daraufhin musste ich der Hebamme ausrichten, dass der werdende Vater sie abholen und sofort mit dem Rad losfährt. Da die Zeit immer mehr drängte und die Geburt kurz bevorstand, immer noch keine Hebamme und der werdende Vater in Sicht waren, habe ich die Gemeindeschwester Elisabeth Fuchs, die Schwester und Heimleiterin vom Kreispflegeheim um Hilfe gebeten. Beide waren aber nicht in Geburtshilfe ausgebildet, aber sie kamen und standen der werdenden Mutter bei. Zum Schluss habe ich Frau Lene Harz aus Berkenthin noch angerufen, denn die hatte mir mal erzählt, dass sie vor kurzem Geburtshilfe geleistet hätte. Frau Harz hat dann die werdende Mutter entbunden. Es sei noch erwähnt, dass der werdende Vater unterwegs von den Tieffliegern beschossen worden ist und sein Rad hinschmeißen musste, um in den Graben und in den Knick zu kriechen. Als der Tieffliegerangriff vorüber war und er sein Rad holen wollte, hatten sie ihm auch noch das Fahrrad gestohlen. Er kam ohne Hebamme und Rad hier auf Schustersrappen wieder an.
Vom Postamt Ratzeburg hatte ich schon Ende April die Anordnung bekommen, sämtliche Wertsiegel, die wir auf dem Postamt hatten, sobald der Feind anrückt, zu vernichten. Kurzerhand habe ich am 1. Mai die Siegel genommen und sie von der Mitte der Fußgängerbrücke in den Kanal geworfen. An der Eisenbahn-, Schleusen- und Fußgängerbrücke wurden Tage vorher riesige Sprengkörper anmontiert, um sie zu sprengen, wenn der Feind näher rückte. Darüber war unser damaliger Bürgermeister Heinrich Schwarz sehr besorgt. Denn er wollte die ganzen Brücken erhalten und vor der Sprengung bewahren. Ganz aufgeregt rief er beim Postamt an, denn wir hatten damals noch Handvermittlung im Fernsprechbereich. lch saß am Klappenschrank, nahm sämtliche Fern- und Militärgespräche entgegen und vermittelte sie weiter, dazu auch alle Ortsgespräche.
,,Gev mi mal Peter Lipp!“, sagte er zu mir (Peter Lipp war der damalige Ortsgruppenleiter der NSDAP), dem sagte er, man solle dafür sorgen, dass die Brücken nicht gesprengt würden. Aber unser damaliger Ortsgruppenleiter, der auch zugleich Meierist war und die hiesige Meierei verwaltete, hatte wenig lnteresse an dem Vorhaben von Bürgermeister Schwarz. Im Gegenteil, er wollte alle drei Brücken sprengen lassen. Ganz verzweifelt legte Bürgermeister Schwarz den Hörer wieder auf, worauf ich die Vermittlung trennte.
Ein paar Minuten später rief Bürgermeister Schwarz wieder an und bat mich, ihn mit der Kreiskommandantur in Ratzeburg zu verbinden. Aber auch hier stieß Bürgermeister Schwarz auf taube Ohren. Die Kreiskommandantur verwies ihn an eine Oberbefehlsstelle in der Nähe von Bad Oldesloe. Auch dort wurde seine Bitte um Erhaltung der Brücken abgewiesen. ln seiner Aufregung und Sorge, dass ihn niemand anhören wollte, auch keine zu einer Verhandlung bereit war, rief er nach kurzer Zeit noch mal auf dem Postamt an. Ganz außer sich vor Aufregung sagte er zu mir: ,,Du muß mi nu mal helpen, gev mi mal dat Sprengkommando, dat de Brücken sprengen söllt“. Da wir jeden Tag vom Militär zwei Parolen durchgesagt bekamen, denn auch die Militärleitungen waren bei uns am Telefonnetz angeschlossen, sagte ich: ,,Herr Schwarz, ich darf Sie nicht vermitteln, wir haben Verbot, Zivilpersonen mit der Militärleitung zu verbinden. Es gibt da Parolen, die genannt werden müssen, um an den Kommandanten heranzukommen.“
lch weiß es noch, als wenn es erst heute gewesen wäre, die erste Parole hieß „Fuchsloch“, und die zweite Parole hieß „Schwarzer Panther“. Bürgermeister Schwarz setzte nun all seine Überredungskunst ein, um mich zu bewegen und zu überzeugen, dass die Brücken nicht gesprengt werden dürfen. lch habe ihm immer wieder klar gemacht, dass für mich ein strenges Verbot besteht. Aber Bürgermeister Schwarz war hartnäckig und sprach überzeugend auf mich ein. Zum Schluss dachte ich, der Mann hat ja Recht, und habe ihn mit dem gewünschten Anschluss verbunden. Damit er auch mit dem Kommandanten, er war, so viel ich mich erinnern kann, ein Major (der Name ist mir leider entfallen) sprechen konnte, habe ich ihm, falls er gefragt würde, gesagt, wie die Parole heißt. Und sie wurde gefragt! Der Major kam ans Telefon und Bürgermeister Schwarz trug seine Sorge und sein Anliegen vor.
Ich hatte mich in die Leitung eingeschaltet und hörte das Gespräch, die Verhandlung zum größten Teil mit an. Ganz überrascht war ich, dass der Major so zugänglich war, er versprach dem Bürgermeister alles zu tun, die Brücken nicht zu zerstören: Wenn nicht noch höherer Befehl kommen sollte. lch selber war erleichtert, dass das Gespräch so positiv verlaufen war.
Aber das dicke Ende kam für mich nach. Einen Augenblick später kam über die Militärleitung ein Anruf für mich, mit strengem Ton wurde mir „Verrat“ vorgeworfen, es würde veranlasst werden, mich abzuführen. Vor lauter Aufregung konnte ich nicht mal meinen Namen sagen, nach dem ich gefragt wurde. ln meiner Angst habe ich meinen Vorgesetzten Herrn Kunze im Postamt Ratzeburg angerufen und ihm erzählt, was vorgefallen war. Herr Kunze sprach ganz beruhigend auf mich ein, ich sollte, wenn jemand käme, um mich abzuführen, ihn sofort anrufen. Aber es kam niemand. Als später der erste Engländer mit einem Kradrad über die Fußgängerbrücke kam, habe ich tief aufgeatmet! Und unsere Brücken waren auch alle heil geblieben.“

In demselben Bericht erinnert sie sich zugleich noch an eine andere, amüsante Beobachtung:
„Am 2. Mai bekam ich die Anordnung eine weiße Flagge aus dem Fenster zu hängen. Wir hängten ein weißes Bettlaken aus dem Fenster. Aber drüben in Groß Berkenthin sah ich, als ich aus dem Postfenster schaute, dass die Altenteilerin Meta Hack an einen langen Stiel eine alte offene weiße Damenspitzenhose gehängt hatte. Trotz der ernsten Lage wirkte es doch recht belustigend auf mich. Außerdem bekam ich die Anordnung, das Dienstzimmer der Post abzuschließen und den Schlüssel mit nach Hause zu nehmen um dort auf weitere Anordnung zu warten. Da noch Brief- und Paketpost im Dienstzimmer lagen, habe ich mir die Feldpostbriefe raussortiert (damit sie nicht den Engländern in die Hände fallen) und mit nach Hause genommen. Später, als sich alles ein wenig beruhigt hatte, habe ich die Feldpostbriefe den Angehörigen zugestellt.“
Die Besetzung Berkenthins verlief dann auch weitgehend friedlich. Am frühen Nachmittag zogen die Engländer in unserer Dorf ein. Während die ersten Soldaten noch „zu Fuß kamen“, (vgl. Bericht Calli Hack) rollten kurze Zeit später englischen Panzer aus Richtung Ratzeburg / Kulpin kommend durch den Ort. Inzwischen hingen an den meisten Häusern große weiße Tücher als Zeichen der Kapitulation. Am westlichen Ufer des Kanals war noch ein Bataillon deutscher Soldaten in Stellung gegangen, die offensichtlich den Übergang feindlicher Truppen mit ihren Panzerfäusten aufhalten sollten. Dazu kam es aber nicht mehr, die Einheit ergab sich ohne Widerstand, so dass es nirgends zu Zusammenstößen zwischen Deutschen und Briten kam. Am späteren Nachmittag des Tages tauchten zwar immer wieder viele Flugzeuge am Himmel über Berkenthin auf, so Pastor Blunk in der Kirchenchronik. Man erkannte und hörte Flakfeuer und vereinzelte Explosionen und nahm Feuerschein und Rauchwolken in Richtung Lübeck wahr, aber für Berkenthin war der Krieg vorbei. Und am Ende des Tages hatte sich auch Lübeck ergeben.
Nach ihrem Einzug durchsuchten die Engländer die Häuser nach deutschen Soldaten, die sich alle auf der Straße zum Abtransport in die Gefangenschaft versammeln mussten. Auch wenn Pastor Blunk von vereinzelten Übergriffen, Diebstählen und Plünderungen durch englische Soldaten zu berichten weiß, verlief doch die Durchsuchung der Häuser insgesamt verhältnismäßig ruhig und korrekt. Heinrich Schwarz erinnert sich: „ Ich war Zeuge, wie sich ein Engländer bei der Festnahme eines Soldaten benahm. Vor dem Haustor des Bauern Soltau hatte (er) einen deutschen Soldaten gefunden, dessen Frau von ihm Abschied nahm. Sie umarmte ihren Mann unter Tränen, der Engländer fasste den Soldaten bei der Schulter, drehte ihn um und bedeutete ihn, er solle vorläufig bei seiner Frau bleiben und ließ beide in das Soltausche Haus zurück gehen“
Er selbst wurde dann spät am Abend von englischen Soldaten in seinem Wohnhaus aufgesucht. Im Laufe des Tages war er als Bürgermeister in seiner Wohnung noch unbehelligt geblieben, da er die Geschäftsräume mit der Bürgermeister-Beschilderung auf seinem Geschäftsgrundstück untergebracht hatte. Da ohnehin durch Anschläge vorher bekannt gegeben worden, dass keiner nach Einbruch der Dunkelheit seine Wohnung mehr verlassen durfte, hatte er sich bereits um 10 Uhr nach der Aufregung des Tages müde ins Bett gelegt. Und Heinrich Schwarz weiter: „ Kurz danach klopfte es an meine Haustür, ein Trupp englischer Soldaten forderte Einlass. Nachdem ich geöffnet hatte, kamen zwei Unteroffiziere in den Flur und verlangten Tee. Als ich versuchte ihnen klar zu machen, dass ich keinen Tee hätte, sagte man zu mir: „Du nicht Tee, wir Tee!“ Sofort wurde ein großer Topf mit Wasser aufgestellt und Tee gekocht. Die Soldaten mussten vor der Haustür warten, keiner durfte in den Flur und jeder erhielt zwei Becher Tee. Ein Unteroffizier hatte inzwischen aus einem Bagagewagen eine Flasche Wein geholt , für mich und meine Frau zwei Gläser aus dem Küchenschrank genommen, diese mit Wein gefüllt und uns bedeutet zu trinken. Ich holte zwei weitere Gläser aus dem Schrank, füllte sie und bot sie den Unteroffizieren zum Trunk an. Beide leerten mit uns ihr Glas. Nachdem alle mit Tee versorgt waren, verließen die Unteroffiziere die Küche und alle krochen vor meiner Haustür in meinem Garten und unter ihrem Bagagewagen und legten sich in ihren Schlafsäcken zur Ruhe. Keiner kam in meine Wohnung. Am nächsten Morgen entspann sich in meiner Küche ein reges Leben, alle wollten den Herd benutzen. Die Soldaten durchsuchten die Stallungen nach Hühnereiern, beschlagnahmten unser Badezimmer und nahmen an Küchengeschirr, was sie brauchten. Von uns nahm keiner Notiz. Nach dem Frühstück zogen sie alle ab, meine Frau bekam als Anerkennung Seife, Schmalz, Schokolade und Kekse auf den Küchentisch gelegt.“
An eine ähnliche Begebenheit erinnerte sich vor Jahren der 2005 verstorbene Berkenthiner Horst Dürkop. Er wurde 1930 geboren und lebte 1945 zusammen mit seinen Eltern und Bruder in dem kleinen Familienhaus in der Rondeshagener Straße. Er hatte Ostern des Jahres die Schule abgeschlossen und war im Begriff, eine Lehre als Friseur anzufangen. Natürlich hatte man auch hier in Klein Berkenthin von den anrückenden Briten gehört und ein weißes Bettlaken aus dem Fenster gehängt. Nun saß die Familie um den Wohnzimmertisch, um mit Spannung die kommenden Ereignisse abzuwarten. Die Haustür hatte Vater Dürkop vorsichtshalber abgeschlossen. Den ganzen Tag über hatte man vereinzelt Granat- oder Panzerfeuer gehört, als schließlich am Nachmittag ein britischer Panzerspähwagen durch die Rondeshagener Straße rollte und direkt vor dem kleinen Haus hielt. Die Familie rückte noch etwas näher zusammen und beobachtete, wie ein Soldat aus dem Fahrzeug kletterte und durch die Gartenpforte direkt auf das Haus zukam. Es klopfte. Der Vater entriegelte die Tür und öffnete. Der Rest der Familie kam ebenfalls aus dem Wohnzimmer und drängte sich hinter ihm. Als die Haustür aufging, stand vor ihnen der britische Panzersoldat und grüßte freundlich. Ganz offensichtlich entschuldigte er sich für die Störung: „Excuse me, Sir….!“ und zeigte auf einen leeren Trinkbecher, den er in der Hand hielt. Und obwohl er genau so wenig Deutsch sprach wie Vater Dürkop Englisch, war doch sehr bald klar, was sein Begehr war: Er bat um etwas heißes Wasser für seinen Tee. Die Mienen aller hellten sich sogleich auf und Mutter Dürkop entschwand sogleich in die Küche, um einige Zeit mit einem Kessel heißen Wassers zurückzukehren. Der Engländer bedankte sich und kehrte mit dem Kessel in der Hand zu seiner Besatzung zurück. Die Dürkops aber konnten noch durch das Wohnzimmerfenster beobachten, wie die Briten auf ihrem Panzer eine Mahlzeit zu sich nahmen und dazu ihren Tee tranken. Erst nach Einbruch der Dunkelheit wurde dann der Motor angeworfen und das schwere Fahrzeug fuhr weiter in Richtung Rondeshagen. Aufatmen! Als sich die Familie später wieder vor die Tür traute, stieß man mit den Füßen auf einen Gegenstand, der auf dem Boden abgestellt worden war. Der leere Teekessel.
Angesichts der täglichen Not und den Geschehnissen in der unmittelbaren Umgebung spielten die übergeordneten Ereignisse wie der Tod Hitlers und der Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes keine Rolle. Im Ort herrsche vielmehr an den folgenden Tagen das Gefühl der Verunsicherung vor, niemand wusste, was die nächste Zeit bringen werde. Immer noch kursierte die Befürchtung, die Russen würden doch noch an den Kanal vorrücken, da vielen der Kanal als die natürliche Trennlinie erschien. Tatsächlich sorgte eines Morgens die Parole, die Russen seien im Anmarsch und die Engländer würden abziehen, für große Aufregung im Ort. Insbesondere die Bauern in Groß Berkenthin hatten schon ihre Treckwagen gepackt, um jederzeit über den Kanal abziehen zu können. Eine Nachfrage des Bürgermeisters beim Kommandeur beruhigte aber die Gemüter. Dennoch hielten sich die Ängste auch längere Zeit. Genährt wurden diese auch noch dadurch, dass einige Tage später in der Berliner Straße britische Kanonen mit der Mündung nach Osten aufgestellt wurden, so, als wollten sie sich der möglicherweisen Sowjetarmee entgegenstellen.
Kontakte nach außerhalb gab es nicht, da die Engländer die Fernsprechleitungen unterbrochen hatten, der Bahnverkehr eingestellt war und auch der Postverkehr unterbrochen worden war. Darüber berichtete Lotti Schreiter weiter in ihren Erinnerungen. Nachdem sich die Engländer einen Überblick über die Zuständigkeiten im Dorf gemacht hatten, erschienen zwei englische Soldaten bereits am Morgen des 3. Mai mit geschulterten Gewehren vor ihrem Haus, um sie abzuholen: „Schreiter, mitkommen!“, hieß es in scharfem Kommandoton. Sie berichtet weiter: „ Ich nahm die Postschlüssel und musste zwei Schritte vor ihnen hergehen, beide Engländer richteten das Gewehr auf mich, denn sie hatten schreckliche Angst vor Partisanen. Als wir zwischen dem Gebäude von Bauer Wulf und Gasthof Meier gingen, schoss jemand in Groß Berkenthin. ,,Stopp!“, riefen die beiden Engländer, ich musste still stehen, bis sie sich vergewissert hatten, dass offensichtlich einer von ihren Leuten in die Luft geschossen hatte. Dann bekam ich mit dem Gewehrlauf einen Stoß und musste weitergehen. Vor dem Postgebäude standen sechs weitere Engländer, ich musste dann das Dienstzimmer aufschließen. Die ganzen Postwertzeichen, Briefe, Päckchen, Pakete und das Bargeld nahmen sie in ihren Besitz. Alles wurde in einem Postsack verstaut und abtransportiert. Meine Kollegin E. v. Wnuck-Lipinski hatten sie auch von der Behlendorfer Schleuse hergeholt. Wir mussten dann eine Liste, worauf die Postwertzeichen, Postkarten und das Bargeld aufgeführt worden waren, unterschreiben. Das Dienstzimmer wurde dann wieder abgeschlossen, den Schlüssel musste ich Bürgermeister Schwarz übergeben. Mit dem Postdienst war dann erst einmal Schluss. Die beiden Engländer begleiteten mich dann wieder bewaffnet zu meiner Wohnung und meine Kollegin nach Behlendorf.“ Der Bürgermeister bekam, nachdem ihm die Schlüssel übergeben worden waren, die Anweisung, streng darauf zu achten, dass kein Mensch die Post zu betreten habe. Danach erinnert er sich an eine merkwürdige Begebenheit: „Ein höherer Offizier musterte mich von unten nach oben und befahl, mich auf die Kühlerhaube seines Jeeps zu setzten. Er fuhr mit mir über die Fußgängerbrücke nach Groß Berkenthin. Gleich hinter meiner Wohung hielt er an und ließ mich laufen. Ich hatte das Gefühl, dass er nur feststellen wollte, ob ich gefügsam sei oder nicht.“
Zur Angst um die eigene Existenz kam nahezu in allen Häusern die Sorge um die angehörigen Soldaten, von denen jede Nachricht fehlte und über deren Verbleib man nichts wusste. Alle Häuser waren zudem überfüllt mir Flüchtlingen aus den Ostgebieten, während die Hauptlast der Arbeit auf den Höfen bei den Frauen und Kindern lag, vor allem nachdem auch die ausländischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter nun in vielen Fällen die Arbeit verweigerten. Diese sorgten für weitere Verunsicherung, da viele von ihnen nicht nur die weitere Arbeit auf den Höfen verweigerten, sondern sich noch dazu nach den eigenen jahrelangen Demütigungen oft herausfordernd benahmen. Diebstähle und Plünderungen waren tagelang an der Tagesordnung, bis die Besatzungssoldaten energisch gegen Diebe und Plünderer vorgingen.
Von einer anderen Begebenheit unmittelbar berichtet Pastor Blunck in der Kirchenchronik. So wurde er am 3. Mai gebeten, drei getötete Männer zu beerdigen. Zwei von ihnen waren deutsche Wehrmachtsangehörige, die auf der Straße von Sierksrade nach Kastorf bei einem Fliegerangriff getötet worden waren. Bei dem dritten handelte es sich zunächst um einen offensichtlich russisch stämmigen Mann in ebenfalls deutscher Uniform. Er war am Tag zuvor in Sierksrade von einem Militärfahrzeug überfahren und zerquetscht worden. Man fand Briefe in kyrillischer Schrift bei ihm, ohne dass sich seine Identität klären ließ. Alle drei wurden in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Berkenthiner Friedhof beigesetzt.
Der Bürgermeister blieb zunächst noch wenige Tage im Amt, bevor er schließlich durch den von der britischen Militärregierung eingesetzten Max Dinklage abgelöst wurde. Bis dahin hatte sich Heinrich Schwarz täglich beim Ortskommandanten zu melden. Zunächst mussten Häuser für die Unterbringung der Besatzungstruppen frei gemacht werden. Bürgermeister Schwarz erinnerte sich, dass die Besatzer seinen Vorschlägen weitgehend Rechnung trugen, indem kinderreiche Familien von Einquartierungen verschont blieben. Auch Lotti Schreiter erinnet sich, dass auch ihr Haus am 5. Mai binnen zwei Stunden geräumt werden musste. Sie fand wie viele andere mit ihrer Familie in dieser Zeit Aufnahme bei den Nachbarn.
Die Besatzungsangehörigen zogen in die beschlagnahmten Häuser. Dann mussten alle Waffen, auch Jagdgewehre, Fotoapparate und Ferngläser abgeliefert werden. Schweren Herzens seien die Gewehre von den Jägern vor seinem Haus an der Kirchhofmauer auf einen Haufen geworfen worden, wo sie einige Tage lagen. Schließlich sei alles von Soldaten durchwühlt worden und schließlich auf Nimmerwiedersehen abgefahren worden. Auch alle Autos und motorisierten Fahrzeuge mussten abgeliefert werden und wurden nach Ratzeburg oder Mölln gefahren. Und hier hätten die Eigentümer nie mehr etwas über den Verbleib erfahren. Täglich mussten den Erinnerungen des Bürgermeisters zufolge 10 bis 20 Mann , die Munition abladen und verteilen und andere mussten Arbeiten für die Engländer verrichten.
Die Kanalbrücken wurden von englischen Soldaten kontrolliert und im ganzen Dorf herrschte nach wie vor nach Einbruch der Dunkelheit Ausgangssperre, deren Einhaltung von den Besatzern streng überwacht wurde. Von 21 Uhr bis 6 Uhr durfte keiner sein Grundstück und nach 22 Uhr keiner sein Haus verlassen. Heinrich Schwarz erinnerte sich, dass er an einem Abend mit Frau und Schwester noch hinter seinem Haus saß, als plötzlich eine Patrouille mit aufgesetztem Seitengewehr kam und sie abführte. „Wir wurden ohne Schuhe und Jacke auf einen Lastwagen geladen und nach Buchholz (ins britische Hauptquartier) zum Arrestlokal gefahren. Wir hatten nicht beachtet, dass wir nach 10 Uhr die Wohnungen nicht verlassen durften.“ Nach einer Beschwerde beim Lagerkommandanten und der Erklärung, dass er seinen totkranken Vater bewacht habe, wurde er mit Frau und Schwester noch in derselben Nacht wieder nach Berkenthin zurückgefahren.
In Behlendorf und in Mölln waren derweil Lager für deutsche Kriegsgefangene eingerichtet wurden. Als sich Nachrichten von der schlechten Versorgung der Soldaten verbreiteten, wurden auf Betreiben des Pastors im ganzen Ort Lebensmittel gesammelt, die zunächst im Pastorat gesammelt wurden und schließlich von den Töchtern des Pastors und der Lehrerin Fräulein Jantzen nach Behlendorf gefahren wurden. Kurze Zeit später wurde auch in Berkenthin auf der Koppel neben dem Bahnhof für kurze Zeit ein Kriegsgefangenenlager errichtet. Die hier auf freiem Feld gefangenen Soldaten bauten sich aus den Holzbeständen des gegenüberliegenden Sägewerks einfache Unterkünfte, die den Pastor in seiner Chronik an Hundehütten erinnerten. Auch die hier Internierten wurden von der Dorfbevölkerung mit Lebensmitteln versorgt, bevor das Lager dann bereits nach kurzer Zeit wieder aufgelöst wurde.
Am 13. Mai, wenige Tage nach der Gesamtkapitulation hielten dann die Engländer in der Berkenthiner Kirche einen Dankgottesdienst für die siegreiche Beendigung des Krieges ab. Da die Engländer selbst für einen Organisten und einen Blasebalgtreter sorgten, musste kein Deutscher am anglikanischen Gottesdienst, der mit dem Singen der englischen Nationalhymne eröffnet wurde und von einem Armeegeistlichen geleitet wurde, teilnehmen. Später wurden dann alle 14 Tage englische Gottesdienste in der Kirche abgehalten.
Am 19. Mai wurde die erste britischen Besatzungseinheit durch eine zweite abgelöst. Gleichzeit wurde nun auch die Fußgängerbrücke mit Stacheldraht abgesperrt, wahrscheinlich um Wachpersonal einzusparen.
Neben den Nöten des eigenen Alltags bewegte viele Berkenthiner in dieser Zeit die Sorge um ihre Angehörigen. Bei Kriegsende gerieten viele junge Männer aus dem Ort, wenn sie denn den Krieg überlebt hatten, in russische, amerikanische oder britische Kriegsgefangenschaft. Von vielen hatte es schon während der Wirren der letzten Kriegswochen und -monate kein Lebenszeichen mehr gegeben. Erst langsam kehrten dann einige von ihnen nach Hause zurück, meist schwer gezeichnet von den Kriegserlebnissen. Oder es trafen Meldungen und Nachrichten aus der Gefangenschaft bei den Angehörigen ein, oft aber erst nach vielen Monaten oder gar Jahren. Vor allem aus den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern wurden erste Kontakte in die Heimat über das Rote Kreuz erst ab dem Jahr 1946 möglich. Immer häufiger trafen aber auch über heimgekehrte Kameraden Todesnachrichten in Berkenthin ein und in vielen Fällen blieb das Schicksal des Sohnes, des Ehemanns, des Vaters völlig ungeklärt. Vom harten Schicksal vieler deutscher Soldaten, die in sowjetische Gefangenschaft geraten waren, berichtet ein Brief über das qualvolle Ende eines Soldaten aus der Berkenthiner Kirchengmeinde, den 1949 ein ehemaliger Kamerad an den Pastor sandte. Dieser Mithäftling hatte sich nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft zunächst mit einer kurzen Nachricht an die Familie gewandt. Auf deren Wunsch hin, hatte Pastor Blunck dann noch einmal um genauere Auskunft gebeten.
Bochum-Dahlhausen, den 9.8.1949
Herrn Pastor Blunck in Berkenthin
Lieber Herr Pastor!
Habe Ihren Brief vom 28.7. erhalten. Konnte Ihnen leider nicht eher Nachricht geben, weil ich krank war. Ich hatte (Name des Verstorbenen) in der Gefangenschaft kennengelernt. Innerhalb des Lagers war ein Lazarett, da hatten wir beide den Sommer 1946 als 3. Kategorie, oder auf deutsch, halb verhungerte Menschen gelegen. (Anm. des Verf: Die Gefangenen wurden in den sowjetischen Lagern in drei Kategorien eingeteilt. Der 1. Kategorie gehörten Gefangenen an, die als noch voll arbeitsfähig eingestuft wurden, die Gefangenen der 2. Kategorie galten als bedingt arbeitsfähig, während die Männer der dritten Kategorie als nicht-arbeitsfähig erachtet wurden.) (….) und ich hatten Wasserbeine und Durchfall. Mitte September hatten wir uns soweit bekriegt und kamen dann in die zweite Kategorie und mussten dann im Bergwerk arbeiten. Ende Oktober kam mein Kamerad dann wieder ins Lazarett und machte dort sein Ende. Weil ich in seiner Brigade war und ich mit ihm befreundet war, brachte ich ihm das Essen hinüber. Am 16./17. November war er gestorben. Das Lager war 256/1 bei Antrzyt (in der südlichen Ukraine). Arbeiten mussten wir, bis wir umfielen, immer Norm. Wer die Norm nicht erfüllt hatte, bekam Schläge, wurde in den Karzer gesteckt und bekam drei Tage nichts zum Essen. Todesursache war verhungert. Die letzten 4 bis 5 Tage war er nicht mehr bei Verstand. Er war nur noch Haut und Knochen.
Er wurde nackend ausgezogen, auf einen Karren geworfen, es waren an dem Tag 11 Mann, die beerdigt werden mussten. Mit 10 Gefangenen fuhren wir zum Panzergraben in Begleitung von 2 russischen Posten. Wir mussten dann den Karren umkippen und wieder zum Lager fahren. Das ist das, was ich über den Tod von …… berichten kann. Ich kann nur unserem Gott danken, dass ich dieser Hölle entkommen bin. Es sind die Jahre 1945 und 46 täglich 10 bis 15 Mann gestorben, hauptsächlich im Winter. Todesursachen waren „verhungert“ oder „erfroren“. Bei 45 bis 50 Grad Kälte waren wir nur notdürftig bekleidet und keine geheizten Räume.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd W.


Bis in die 50er Jahre hinein trafen immer wieder solche verspäteten Todensnachrichten im Ort ein. Sie wurden jeweils in einer sogenannten „Heldenehrung“ im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst geehrt. Zudem widmeten ihnen Pastor Blunck in der Kirchenchronik eine ausführlichen Lebenslauf, in denen er ihre Schicksale skizzierte und rettete sie damit vor einem frühzeitigen Vergessen.
Die Darstellungen stützen sich in weiten Teilen auf die Eintragungen in der Berkenthiner Kirchenchronik a.a.O. Andere wichtige Quellen sind die unveröffentlichten Lebenserinnerungen Heinrich Schwarz´ sowie die ebenfalls unveröffentlichten Erinnerungen Lotti Schreiters.
Der Bericht über den Flugzeugabsturz basiert auf der Dokumentation „Die Straße der Bomber. Flugplätze, Fliegerangriffe, Luftkämpfe und Flugzeugabstürze während des 2. Weltkrieges im Kreis Segeberg und Umgebung“ des Arbeitskreises Geschichte im Amt Segeberg Land, ISBN 3980495981, ergänzt durch ein unveröffentlichtes Manuscript Walter Koops.
Andere wertvolle Quellen waren mündliche Erzählungen inzwischen verstorbener Berkenthiner: Calli Hack, Host Dürkop, Helga Dresow u.a.