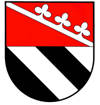Der 30-jährige Krieg: 30 Jahre Mord und Totschlag
Durch die Reformation 1517, die in der beschriebenen Weise auch Berkenthin erfasste, hatte sich Deutschland in ein katholisches und ein protestantisches Lager gespalten. Beide Lager standen sich aber nicht nur wegen der konfessionellen Gegensätze, sondern aus machtpolitschen Gründen zunehmend feindlich gegenüber. Im Jahr 1618 entbrannte durch einen relativ harmlosen Zwischenfall, den sogenannten „Prager Fenstersturz“ ein europäischer Konflikt, der zu einem Dreißigjährigen Krieg werden sollte. Die Leidtragenden dieses langjährigen Konfliktes waren hauptsächlich die Bauern und kleinen Leute. Als der Krieg schließlich mit dem Westfälischen Frieden beendet wurde, waren ganze Landstriche verwüstet und nach heutigen Schätzungen etwa 6 Millionen von damals etwa 18 Millionen Menschen in Deutschland ums Leben gekommen.

Der 30-jährige Krieg war 1625 mit Mord und Totschlag, mit Verwüstungen, Plünderungen und Brandschatzungen auch in das Lauenburgische hineingeschwappt. Der regierende Herzog August hatte zwar versucht, Neutralität in diesem Glaubenskonflikt zu wahren, seine Söhne hatten sich sogar als Feldherren in beiden Lagern verdingt. Dennoch hatte das Herzogtum verschiede Truppendurchzüge zu erdulden. Schon 1618 floh Friedrich von der Pfalz nach seiner Niederlage am Weißen Berg in Böhmen nach Lübeck, wobei er das Herzogtum durchquerte. 1525/26 erfolgten die nächsten Truppendurchzüge, als die protestantischen Truppen unter Führung des dänischen Königs nach Norden flohen. Weitere Truppendurchzüge mit den einhergehenden Einquartierungen und Plünderungen erfolgten dann in den Jahren 1634 bis 36, 1643 und 45, jetzt vor allem durch schwedische Truppen. Insgesamt kamen die Städte jeweils glimpflich davon, aber vor allem die Dörfer, wo sich die Truppen bequem verpflegen konnten, erlitten große Schäden.
Bürger und Bauern wurden mit Kriegssteuern, Requisitionen und Einquartierungslasten bedrückt. Am schlimmsten aber trieb es das Gesindel, das den Heeren plündernd und raubend nachfolgte: versprengte Abteilungen, Deserteure und allerhand Schnapphähne (Straßenräuber). Selbst das Raubritterwesen lebte damals gelegentlich wieder auf. Neben aller Zerstörung, Not und Elend berichten die Chronisten dieser Zeit von einer allgemeinen Verrohung der Sitten. Später resümierte Pastor Lüders in der Berkenthiner Kirchenchronik zutreffend: „Fanatismus, der Habsucht der Emporkömmlinge und der viehischen Gier der Soldaten wurde auf das Volk angesetzt. Von Haus und Hof vertrieben oder in ewiger Angst vor den Soldaten, ohne allen Unterricht, was bleib den nur diesem Geschlecht anderes übrig, als feige Niederträchtigkeit und jene schändliche Sittenlosigkeit, wie von den Soldaten gelernt? Was Gott sie gewiesen, es galt nicht mehr….“
Die Quellenlage für diese Zeit ist für Berkenthin relativ dünn. Die Groß Berkenthiner Bauern waren seit Ende des 16. Jahrhunderstz zum Hof Anker zwangsverpflichtet, hatten also ihre Hand- und Spanndienste dorthin zu leisten. Während aus einigen Nachbarorten ausführliche Berichte über die Kriegsgräuel selbst vorliegen, lassen sich die Folgen des Krieges für unseren Ort nur indirekt aus vorliegenden Zahlen erschließen.
So waren in Groß Berkenthin von den vorher neun Hufnern 1639 nur noch 5 übrig, die abgabenmäßig zur Kasse gebeten werden konnten. Der Bauer Hans Wiese war 1629 so arm, das er seine Hofstelle an den Ankerschen Amtsschreiber Hans Philip Capito verkaufen musste. Über den Hufner Claus Gebert heißt es 1652 „war so armsehlig weill selbiger ein neu Hauß gebeuret„. Zum Hufner Max Vicke heißt es „mit dem selben ist es schlecht bestellet„. Auch stand es nicht besser um den Hufner Magnus Wulf „mit dem selbigem ist es leider nicht besser und ein zerbrochen Hause„. Die Bauernvogtstelle mußte mit Heinrich Hund neu besetzt werden, wobei der damalgie Pastor Peter Hund und sein Bruder der Amtmann Andreas Hund sicherlich ihren Einfluss geltend gemacht haben. Auch den Klein Berkenthiner Bauern erging es nicht besser. In einer „Specifikation“ von 1660 gab der Gutsherr Hartwig von Parkentin zum Zecher [*1578; † 1642] an: „Parkentin: 4 besetzte „Baustedte“, 1 besetzter Kossat. 1 unbesetzte „Baustedte“. Die Untertanen sind vom Kriege „sehr verdorben und beij letzter Kriegs Unruhe mehrenteils umb all Ihr Vieh gebracht worden“.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit den fremden Söldnern ab 1625 wiederholt Pest- und Pockenepidemien ins Land kamen, die oft genug mehr Opfer als die eigentlichen Kriegshandlungen forderten. So wurde bei der letzten Pest 1638 / 39 fast die ganze Bevölkerung Duvensees und Hollenbecks dahingerafft.
Ein kurzer Blick in die direkte Umgebung mag einen Eindruck davon vermitteln, wie mit Sicherheit auch unser Ort von der Kriegsfurie heimgesucht wurde. So lässt Peter Jürs in seiner Familienchronik Hack Pastor Jacob Köster aus Nusse zu Wort kommen, der von einem Überfall der Mannsfeldischen Soldaten 1625 auf das Gut Ritzerau berichtet: Die Soldaten „haben all ehren Muthwillen daran geübet, die Unterthanen …fast um all das ihre gebracht, bis sie endlich den 14. Februarii 1626 …wiederum davon zogen. Gott bewahr uns vor solche Gäste in Gnaden ferner.“
1627 fielen die Kroaten des Generals Tilly mit über tausend Mann „mit Macht“ in Nusse ein und plünderten, was nicht Niet und Nagelfest war. U.a. wurde die Kirche aufgebrochen und ausgeraubt. 1638 klagte ein Pächter Peter Claus, am 25. August 1637 sei er „in der Nacht von 200 Reutern überfallen worden, welche alles zerhauen, fast tyrannisch umgangen, einen von den auf dem Hofe vorhandenen Arbeitern erschossen, mich nackend ausgezogen, daß ich ährlich mit dem Leben davongekommen, mein Weib und Kinder in den Morast sich verkriechen (haben) müssen.“ Bauern wurden ausgeplündert, Hunderte von Pferden und Kühen wurden gewaltsam genommen. Der Hof in Anker wurde ebenfalls geplündert. Aber auch im benachbarten Siebenbäumen wurde alles geraubt. Der dortige Pastor Petrus Damerovius (1616-1665) berichtet 1629, dass die Soldaten 1627 die Kirchenkühe, den Kelch und einen weiteren Kelch aus Zinn gestohlen hätten. Unter den Ausgaben im Kirchenrechnungsbuch findet sich dann noch ein Posten „für fenstern, so das kriegesvolck ausgeschlagen in der kirchen und der küsterei“. Die ausgeschlagenen Fenster sind nun nicht eine Tat sinnloser Zerstörungswut, sondern haben auch einen zweckdienlichen Hintergrund. Dazu ein Reim aus dieser Zeit:
De Sweed is kamm,
Hett all’ns wegnahm;
Hett de Finstern in smeten
Un dat Blie rut räten;
Hett da Kugeln ut gaten
Un hett all’ns verschaten
Daneben berichten uns die Quellen von eher harmlosen Begebenheiten aus Berkenthin, was aber nicht besagen soll, dass der Ort nicht auch wie viele andere viel schwerer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ende 1632 lieferte der Berkenthiner Schleusenmeister Hartwig Meyer 2 Tonnen Bier nach Göldenitz für die dort einquartierten Soldaten des Herrn Oberst von Plessen (Daniel von Plessen *1606, † 1672).
Auch gilt als gesichert, dass der damalige Pastor Peter Hundt sein Korn 1636 beim Herranrücken der Schweden zur Sicherheit bei Hinrich Wilms in Klein Berkenthin versteckt hatte. Wilms war lübscher Untertan und galt deshalb als vor Überfällen sicher, denn die Lübecker hatten Schutzzahlungen an die Schweden geleistet. Die Schweden brachen aber trotzdem bei ihm ein, plünderten das Haus und raubten den Roggen. Wilms konnte immerhin einige Tage später einen Teil der Säcke wieder zurückkaufen und verschiffte diese für gutes Geld nach Lübeck. Dadurch bekam er allerdings Ärger mit dem Pastor, der natürlich sein Korn wieder haben wolle. Zur Strafe verweigerte Pastor Hundt ihm zwei Jahre lang das Abendmahl.
1644 wurde ein schwedischer Rittmeister von Jacob Reimers in Groß Berkenthin erschlagen. Daraufhin wurde dieser in Lübeck ins Gefängnis geworfen. (AHL Urfehden Nr. 1257). Leider wissen wir nicht mehr über diesen Fall. Reimers könnte der Sohn des 1614 genannten Berkenthiner Hufners Hans Reimers gewesen sein.
Ähnlich betroffen war auch das benachbarte Rondeshagen. Hier berichtete der Gutsherr Gotthard von Tode d.J. (*1633; † 1697) 1666 an die Lübecker Kämmerei „einmal zu schwedischer Satisfaction etwas hergeschossen worden …“ und 1667 : „besonders das unsrige oftermals bis auf den eußersten ruin im Kriegeswesen eingebüsset“.
Ende April 1638 war die kaiserliche Reiterei des Obristen Graf von Puchheim auf dem Krummesser Gut einquartiert und hatte dort beträchtliche Verwüstungen angerichtet.
in Bearbeitung
Das Jahr 1628 galt als Jahr ohne Sommer und bildete den Tiefpunkt der kleinen Eiszeit am Beginn des 17. Jahrhunderts. Schon Mitte September wurde es empfindlich Kalt und im Oktober brach schon der Winter mit Schnee ein. Mit dem Lübecker Frieden von 1629 war zwar vorübergehend wieder Ruhe ins Land gekehrt, aber durch den schlechten vorangegangenen Sommer fehlte es überall an Lebensmitteln bzw. waren diese kaum noch bezahlbar.

Unser Kriminalfall beginnt am Dienstag Abend den 8. Januar 1630 in der Mühlenstraße in Lübeck. Vater und Sohn Asmus Soltau, beide mit gleichem Namen, aus Groß Berkenthin, hatten eine Wagenfuhre von Lübeck nach Hamburg angenommen. Wagenfuhren waren zu jener Zeit ein übliches Zubrot für die großen Bauern an der Heerstraße zwischen Lübeck und Hamburg. Zudem waren die Zeiten schlecht und jeder Taler war willkommen, um dass kärgliche Leben erträglicher zu machen. Asmus Soltau junior wurde am Mühlentor von einem 22-jährigen Mahlergesellen, namens Lorenz Köhler angesprochen. Dieser hatte wohl mitbekommen, dass die Soltaus auf dem Weg nach Hamburg waren und bat darum sie zu begleiten, und seinen Wertsack vorn mit auf den Wagen legen zu dürfen. Diese kleine Gefälligkeit sollte dann auch nicht zum Schaden der Soltaus sein und er versprach ihnen ein angemeßenes Biergeld in Hamburg als Lohn.
Da es schon spät am Tag war kamen sie nur bis Berkenthin und übernachteten auf Soltaus Hof. Am nächsten Tag ging es weiter über Göldenitz und Nusse nach Witzhave, wo man die nächste Nacht verbrachte.

rot markiert das Steintor

Am Dritten Tag fuhren sie über Glinde weiter nach Hamburg. Sie passierten das alte Steintor und bogen in die Steinstraße ab. Hier wollte sich nun der Geselle von ihnen verabschieden und verlangte nach seinem Wertsack. Doch dieser war verschwunden. Auch nach langem Suchen und gegenseitigen Beschuldigungen fand sich dieser nicht wieder an. So beschloß der Mahlergeselle die beiden Soltaus wegen Diebstahl bei der Wette (Polizei) anzuzeigen. Die Wetteherren nahmen die beiden Soltaus gefangen und der Richter entschied drei Tage später, dass die Soltaus dem Mahlergesellen 24 Reichstaler erstatten sollten. Sie wurden wieder frei gelassen und bekamen einen Zettel zur Einlösung der Schuld für die Lübecker Wette mit.
So machten sich die Soltaus wieder auf den Rückweg nach Berkenthin. 24 Reichstaler waren eine ungeheure Summe und Soltau junior erklärte seinem Vater, dass sie die Summe unmöglich aufbringen könnten, es sei denn, sie würden die beiden Ochsen aus dem Stall verkaufen. Besser wäre es aber wohl den Mahlergesellen einfach zu erschlagen. Darauf nahm Soltau senior ein Beil vom Wagen und drückte es seinem Sohn in die Hand. Dieser erwiederte, er könne dies nicht tun, um seiner Zukunft willen. Doch der alte Soltau wollte dies nicht gelten lassen und drohte damit, wenn er es nicht tun würde, wäre er nimmer mehr sein Sohn.
In Glinde stieß dann auch wieder der Mahlergeselle zu Ihnen, der wohl mit seiner Begleitung sicherstellen wollte, dass die Soltaus den Zettel tatsächlich auch in Lübeck einlösen würden. Falls sie dies nicht täten, drohte er ihnen damit ihr Haus anzustecken.
Ein paar Dörfer weiter in Kötel trafen sie dann Soltaus Schwager Hans Sedemunt aus Kählstorf. Sedemunt war Knecht auf Soltaus Hof in Berkenthin und hatte den Auftrag zwei frische Pferde zum wechseln ihnen entgegen zu bingen. Der alte Soltau erzählte seinem Schwiegersohn gleich die ganze Geschichte und bot ihm einen Reichstaler, wenn er den Mahlergesellen erschlagen würde. So fuhren sie in Begleitung des Mahlergesellen nun weiter bis Berkenthin.
Dort abends angekommen machte ihnen die alte Soltau erstmal ein kräftiges Mahl, damit sich alle wieder aufwärmten, und bei dem wohl auch das eine oder andere Bier geflossen sein wird. Unter fadenscheinigen Gründen lockten dann der Sedemund und Vater und Sohn Soltau den Mahlergesellen aus dem Haus und machten einen Spaziergang an der Stecknitz bis nach Hollenbek. Es war eine kalte sternenklare Nacht, und der Mond schien hell. Am Schwartberge angelangt, holte Sedemund in einem unbeobachteten Moment sein Beil aus der Tasche und schlug hinterrücks auf den Mahlergesellen ein.
(5711)

hierzu s.a. Höfefolge Hufe 3
Acta inquisitionalia in causa criminali contra
Asmus Soltau von Großen Berkenthin aus dem Lande Sachsen, in puncto comissi homicidii (begangenem Mord) de anno 1634 (1630). (Asmus Soltau aus Berkenthin (LASH Abt. 107 Nr. 1 )
Designation
1. Protokoll über das gänzl. Verhör des Ansteten Claus Soltau, Cismar den 23. Sep. 1631
2. Ab… bekenntniß desselben in gegenwarth des Predigers zu Grömitz u. Grube d. 2. Okt. 1634
3. Schreiben des p. 4 Amtgerichtes Claus Kröger an den Hochweisen Rath H. Dr. David Gloxin zu Lübeck de dat. den 14. Okt. 1634
4. drei Schreiben des Dr. D. Gloxin an den Amtsschreiber zu Cismar respo vom 6., 11. u. 25. Okt. 1634
5. Schreiben des amtsschreibers Krüger zu Cismar an die Beamten zu Ratzeburg in Exhibition der Acten in peinl. Sachen des Asmus Soltau und Hans Sedemund den 1. Nov. 1634
6. Antwortschreiben der Beamten zu Ratzeburg den 4. Nov. 1634
7. Acta inquis. general .. Specialia in sämtl. Sachen des Asmus Soltau u. Hans Sedemund, Ratzeburg resp. vom 28. Jan. u. 11. Febr. 1630
8. Puncta welche den Eidungsleuten zu Cismar vorgelegt worden um danach über Aßmus Soltaus ein urtheil zu sprechen den 14. Nov. 1634
9. Protocollum über daß abermalige Bekenntniß deß Clauß Soltau den 14. Nov. 1634, nebst dem von den Eidungsleuten über ihn abgesprochenen Urtheil
10. Bericht des Amtsschreibers Kröger wegen dieser Sache an den Kanzler [Erich] Hedeman zu Gottorff auch zugleich über einen andern Angeklagten nahmens Evers Cismar d. 17. Nov. 1634
zu 10.
… daß theils hausßleute Knechte uff dem Hoffe Campe sich muthwillig bezeigt und verhalten, und alß wir von denselben zwey deßwegen zu gefencklicher Hafft gezogen, so haben wir bey solcher verhafftung vernommmen, daß der eine Aßmus Soltau genant vor ohngefehr 4 Jahren, nebenst seinem Vater und Schwagers bruder, zwischen Lübeck und Hamburg, einen Wandersman ermordet und umbs leben gebracht,
und als derselbe von unß deßwegen, wir undt uff waß maaße es sich mit solcher vermordung zugetragen, so hat er uff solche befragung gutlich bekant und außgesaget daß er solche tath nebst oberwehntem beiden Personen verrichet, und wehren auch darauff seine beede gehelffen in den dritten tags hernach gefenklich angenomben, naher Ratzburgk geführt, durch den Scharfrichter daselbst mit dem Schwert justifizirt, und ihre Häupter uff einen Pfahl gesteckt worden,
als er aber eben dahinmahl in anderem Dorff gewäsen, und selbige geforderte annehmung erfahren, hätte er den flüchtigen fueß gesetzt und sich davon gemacht. Wie dan seine deßwegen getahne gütliche, und hirbey liegende Uhngunsten mit mehren außreißet, Nachdeme wie nun umb mehre nachricht, ub erlangung der Uhre guthen, so des verstrickten Vater, und Schwagers bruder, dieser beschehenen dath halber, zu Ratzburg geleistet, an die Cantzley Räthe daselbst geschrieben, und solche ermelte Uhrguth von den Ratzburgischen Beambten unß daruff übersant worden, alß haben wir altem dieses Ambts gebrauche nach, aber des verstrickten eigener gütliche bekentnuß, und die von seinem Vater und Schwager Bruder zu Ratzeburg getahne Uhrgerichten findungs leute beruffen, dem vorstreckten in ihrer gegenwart, die Puncte von den Uhrgerichten vorgehalten und von Ihnen begehret, findung an zustellen, und daruff ein Urteil einzubringen, Waß nun der Gefangener uff Ihme vorgehalten Puncte sich erklert und die findungsleute vor ein Urteill darauff eingebracht, auch waß in dieser sach ergangen, selbiges ferner E.E. Großachtb. und Hochgel. gssd. auß den hierbeyliegenden Acten großgonstig zuvernehmen haben und gelangt hierüb den derselbe unter dienstlich pitten, Sie wollen großgonstig geruhen, wie wir unß in dieser sache weiter zuverhalten, bey Zeugen deßwegen abgefertigten botten unß großgonstigen befehlig ertheilen.
Alldieweill auch nebst vorgedachten knechte (5666) noch einer Heinrich Everß genant, umb gleicher ursach halber daß er sich uff dem Hoeff Campe wiederspenstig verhalten, alhie gefenklich eingezogen worden, und derselbe auch in eines Ehrwürdigen Thumb Capituls guete zu Lübeck, im Dorf Grombte vor 7 Jahren einen Mordanschlagh begangen, nachdeme nun derselbe des Niederschlags halber, Eingesessene des dorfes Grömbte etliche erwiesen, daß er ein nothwehr an dem von Ihm entleibten gethan und er deß verübten muthwillig eine Zeit hero mit gestendnuß gestrafft, alß haben wir ihm uff leistung burgschaffen wan uff Ihm in künftig etwaz zusprechen, sich alßdann wiederumb ein zuselben, der haffte erlaßen.
Und sollen hierbey E.E. Großachtb.und hochgel. gssd. hirmit angemeldet nicht lassen, wie daß ohnefehr 3 Wochen vor Michaeli eines Hausmans Weib zur Grobe Anna Jürgens, des Gertners Frauen zu Eutin, so sich ebenfalß zur Grobe [Grube] heußlich auffgehalten mit einer Grabforken eberselben, derselben zwo stiche aber die newe, und einen stoß in die rechte seiten damit zugefügt, Nachdme nun dieselbe nach solchen empfangenen schlägen und stoße, sich jederzeit fast übell befunden, auch ihrem bruder, welcher ebener gestalt alhir zu Grobe wohnt oft und viell mahls geklagt, daß Ihr solche zugefügte (5667) schläge und stoß, den tot thun wurden darauf sich auf 3 mahlen wiedergelegt, und ist nunmehr von dieser Welt geschieden, alß nun selbige sowoll gegen ihren beicht Vater, welchen in ihrer krankheit ihr daß heilige nachmahl verricht, alß auch gegen andere leute, und nach zwo stunde vor ihrem tode, wie Ihr balt die strafe vergeben wollen, bekant, daß sie von allsolchen schlägen, und auß keiner andern ursachen daß leben bueßen müßte, so haben wir selbige tätherin, weill dieselbe schon vor diesen etliche mahl schlägerei in ihrer an benachbarschaft angericht, biß uff weiter befehligs, alhir zum Cismar in gefenkliche Hafft genomben.
Wann wir nun nottürrftiglich erachtet dießen Cehem E.E. Großachtb. und hochgel. gs-. zu … Cismar am 17ten Novembris Ao 1634
Dienst. und stetswillige Christoff Lützow, Claus Kröger
An den Herren Cantzler zu Gottorff Erich Hedemann
(5669) zu 9 (Urteil)
Protocollum den 14ten Novembris Anno 1634
Ist der zum Cismar Verstrickte Aßmus Soltau vor die Beambte daselbst, in gegenwart und bey sein der findungs leute, vorgefordert, seine, seines Vaters und Schwagers Brudern, wegen der von Ihm verrichteten morttath getahne Uhrgüthen, Ihme vorgelesen, und waß er dawieder einzuwenden, von Ihm zu sagen, angedeutet worden.
Uff seine getahne Urguth, gestehet er wie folget.
Ad 1
Affirmat.
Ad 2
Sagt er, daß er sich in etwas in diesem Puncte verlauffen, dan er zwar dem ermordeten dem dritten schlag gethan, er hette seines Schwagers Bruder aber Ihm den vierten und letzten strich gegeben, von welchem schlage der ermordete tot geblieben, wiße er nicht, weill es finster gewesen laut seiner zuletzt gethanen Uhrguth.
Ad 3
Affirmat
Ad 4
Affirmat (5670) dto. – 9
Uff seines Schwagers Bruder Hanß Sedemunten geleistete Uhrguth, berichtet er nachfolgender gestalt.
Repetirt seine zuletzt getahne Uhrguth, daß er uff den ermordeten nicht mehr den einen schlags, mit dem beill gegeben, und wie er solchen strich dem Entleibten gericht, hette Sedemunt auch zugleich mit seinem (5671) in händen habenden beile zugeschlagen, nach welchen beiden schlägen der ermordete tot blieben.
Ad Artic. 2
Wiße sich nicht eigentlich zu entsinnen, daß er wegen verkauffung der Ochsen, gegen seinem Vater soll gedacht haben, daß er aber demselben gerathen, den Kerll tot zuschlagen, selbiges wehre er nicht gestendig, dan sein Vater Ihm mit gewalt zu verrichtung dieser morttath gezwungen, in deme er Ihme seine Schräpe auß der Handt genomben, daß beill auß dem Wagen gelangt, Ihme selbiges in die handt gethan, und mit solchen Wörten angeret, er solte dem anderen Knechte, Sedemunt damit meinent, folgen, und den Mahler tot schlagen, Woruff er Verstrickter Ihme zur antwort geben, er wolte und könte es nicht thuen, er wehre noch jung, wo er pleiben solte, uff welch seine entschuldigung sein Vater zu Ihme geret, er solte es thuen, oder er wolte Ihme nicht vor seinen Sohn halten, Woferner aber er nicht wolte, solte er vor den Teuffell lauffen, also hette er die tath, durch, seines Vaters hartes anstrengen mit verrichten helffen müßen.
Ad artic. 4 et 5
Negat, Repetirt daneben seine vorige (5672) Außage, daß er uff den ermordeten nicht mehr den einen schlag gegeben.
Ad art. 7.
Affirmat
Uff welche dem Verstrickten vorgelesene Puncte, seiner verantwortung und bekentnuß, die findungsleute in die Acht gangen, und durch Tonnis Dauwman und Heinrich Begahn von Sibstorff, wie auch Ertman Wulff, zur Grömbte, nachfolgendes Urteill einbrigen laßen.
In Sachen Aßmuß Soltouwen, wegen der vonn Ihme, seinem Vater und Schwager Bruderm, an einem Mahler verrichteten morttath. Erkennen die sämbtlichen findungsleute vermüge sein des verstrickten eigener guetlichen bekantnuß, und der zu Ratzeburg, von seinem Vater und Schwagers bruder ergangenen Uhrguthen, vor Recht,. Daß zwar der beschehenen morttath halber, er verstrickter andern zum Abscheue, mit dem (5673) Rade vom Leben zum tode hinzurichten sey. Weill man aber ohne diese tat von Ihme nichts bärstes mehr erfahren, alß möchten I. G. d I. Ihme mit dem Schwert begnaden, und dadurch daß leben nehmen laßen. Decretum Cißmar am 14ten Novembris Anno 1634
Claus Kröger Ambtsschreiber daselbst
(5681)
aus dem Geständnis des Hans Sedemunt Ratzeburg 28. Jan. 1630
Er Sedemunt hette zwar dem vermordeten, den ersten schlags mit dem beile hinten dem nacken geben, Wehre aber er der vermordete nicht gefallen, besonderen hette nur etwaz genußelt, Soltauen Sohn hette aber ferner auff dem Mahler zugeschlagen, und beides hinten und vorn Ihme daß gehirn gegruset und eingeschlagen, darauff der ermordete zur erden gestürzet, und tot geblieben.
Ratzeburg 11ten Februari Anno 1630
Aßmuß Soltouw der Sohn hette gesaget, Vatter Ihr könnet daß gelt nicht aufbringen, oder Ihr müßet die Ochsen auß dem Stalle verkauffen, dan der Mahler hette gedrauwet, der (5682) rote Hane solte dernach krehen, wo Ihme sein gelt nicht gegeben würde, welche worte der Mahler noch bey Kötell geret, derowegen der Sohn den Vatter auch gerathen, den kerll tot zuschlagen.
Aßmuß Soltouwen Sohn, hette den ermordeten mit einem beile hinten an den Kopff geschlagen, daß er gestürzet, und alß der erschlager sich am Schwartberge gewoltert, und etliche mahl geruffen, Ach Gott hette derselbe Ihm nochmalen vorn an den Kopff geschlagen, Aßmus Soltouw der Vater, hette Ihm gesaget, daß sie es also machen sollen.
Er Sedemunt hette Ihm bey dem füße, Vater und Sohn die Soltouwen bey dem Kopff rund umb genomben, und in die Stekenitz an daß Ufer geschlepfet, wie solches der Vater vorhero befohlen. (5683)
(5684) Sagt er, das sein vater und schwager Bruder, wegen dieser beschehenen morttath, den dritten tags hernach, wehren gefencklich genommen nach Ratzburg gebracht, durch den Rathknechten daselbst mit dem Schwert justifiziret, und ihre Häupter uff einen pfahl gesteckt worden, Weill er eben dazumahl in einem andern Dorff gewesen und erfahren, daß seine beeden gehelffen wehren gefencklich genomben, hette er sich davon gemacht.
(5685) Aus dem Geständnis des Asmus Soltau Vater, auch Aßmus genannt:
den 11ten Februar Ao 1630
Ad Art. 8.
Sein Sohn Aßmus hette Ihm auch mit einem beil geschlagen, und sey die wunde im Kopff gewesen.
Ad Srt. 9
Alß der entleibte tod gewesen, hetten er der Vater denselben bey dem einen arm, sein Sohn bei dem andern arm, und Hanß Sedemunt bey den fueßen in die Stecknitz geschlepffet.
(5688)Auff eingeholete kundschafften und gütliche bekantnuß, wegen eines ermordeten, auff offentlicher Heerstarße, und in die Stecknitz geworffenen Menschen, seint die verhaffte nachfolgender gestalt befragt, Actum Ratzeburg den 11ten Februarii Ao 1630
Aßmus Soltouw (Vater)
1. Ob nicht wahr, daß mit Ihm und seinem Sohn auch Aßmuß genannt, ein Knecht von 22 Jahren, ein reisender Geselle, welchen sie vor einen Mahler hielten, von Lübeck nach Hamburg gereiset, Ihnen einen ledern watsack uff dem Wagen mit geben, und wie er zu Hamburg kommen, denselben genißet, und von Ihnen wieder haben wollen, derowegen er sie aldar arretiren laßen.
2. Ob nicht der Richtherr zu Hamburg zum bescheide gegeben, daß er Ihm 24 Rthl. vor den verlohren wartsack wieder geben solte, er auch solches alß bekebet, und ein Zettell nach Lübeck mitgegeben.
3. Ob nicht derselbe Mahler geselle, welches nahmen man Lorentz Köhler hielte, nicht mit Ihnen vonn Hamburg nach Lübeck gereiset, in meinung die 24 Rthl. alda zu empfangen.
(5689) 4. Ob er nicht Hansen Sedemunt, welcher unter wegens zu Kötell 2 Pferde seinem bruder nachgebracht, angesprochen und beredet, Er solte den reisenden Mahhn den Mahler tot schlagen, Er wolte Ihm einen Reichstahler geben.
5. Ob Hans Sedemunt sich deßen zu erst nicht geweigert, und gesaget, Er würde ihme doch den Reichstahler nicht geben, wan ers schon täthe, Er Ihme aber denselben zu geben nochmalen verheißen.
6. Ob nicht wahr, daß Hanß Sedemunt und sein des Gefangenen vorbenannter Sohn Aßmuß Soltouw dem reisenden Mahler gesellen, wie er den fußsteig bey Hollenbeck gangen, gefolget.
7. Und Hanß Sedemunt mit dem Beill hinter werts im Kopff einen Schlag gegeben, darvon er alßbalt zur erden gestürzet und gerueffen, ach, welches er von ferne gesehen und gehört.
8. Ob nicht daruff der außgetrettene Sohn, Aßmuß und Hanß Sedemunt noch zugeschlagen.
9. Ob nicht wahr daß er selbst und sein Sohn Aßmuß, nebenst Hanß Sedemunt, den erschlagenen Mahler gesellen, etwaß auß dem wege geschleppet, in die Stecknitz geworffen, alda liegen lassen, und ihres weges (5690) gefahren.
10. Ob ernicht nach verrichteter taht, huet und Mantell abgenommen, auff den Wagen gelegt und behalten.
Hanß Sedemunt von Köhlsdorff ist gütlich befraget:
1. b nicht wahr, daß die zeit, wie er seinem Bruter, welcher mit Aßmuß Soltouwen nach Hamburg gewesen, 2 Pferde zu hülfe vor führ nach Kötell gebracht, gedachter Aßmuß Soltouw Ihm geklaget, daß er dem reisenden gesellen, welcher sie den Mahler nenten, wegen eines verlohrenen wartsacks, daran er doch unschuldig, 24 Rthl. zu geben, durch den Richteherrn zu Hamburg verdammet worden.
2. Ob nicht wahr daß Aßmuß Soltouw gesaget, Ihm unmöglich so viel gelt, aufzubringen, und solte er hanß Sedemunt, nebenst Aßmuß Soltouwen Sohn, den Kerll oder Mahler gesellen, hinrichten, er wolte Ihm 2 Rthl. geben.
3. Ob er nicht mit den andern Knechte Aßmuß Soltouwen Sohn, auch Aßmuß genant, dem Mahler gesellen, wie er den fußsteig bey, N. gangen, nachgefolgt, und er hanß Sedemunt 2 Stunde (5691) zu abend bey Mohnschein den Sontag abend sein beill genommen, und dem Mahler gesellen von hinten zu, einen Schlag mit dem beill in den Kopff oder NAcken gegeben, daß er dabey genußelt und zur erden gestürzet.
5. Ob nicht Soltouwen Sohn Aßmuß auff denselben Menschen weiter zugeschlagen, Ihn hinten und vorn in den Kopf und Hirn mit dem beill ebell zugericht, daß er auch davon gestorben.
6. Ob nicht der alte und jetzt mit gefangene Aßmuß Soltouw von ferne nicht gahr weit gestanden, und solches angesehen.
7. Ob er benanter Soltouw der alte nicht zugelauffen, und den erschlagenen Körper auß den wege nach der Stecknitz mit Ihme und den entwichenen schleppen und darin werffen holffen.
8. Ob nicht der alten Soltouwen Frawe denn folgenden Sontag, wie sie alle drey den Sonabent zuvohr diese tath verrichtet, Ihme Sedemunten 1 Rthl. geben wollen, Er aber, weill Ihme die taht gerewet, denselben nicht annehmen wollen.
(5692) Item ob auch der geschlagener sonsten an gelde etwas bey sich gehabt, und ob sie Ihme die Kleider nicht außgezogen.
B. Inaratus Ob er auch solche tath, vor sich alleine sonsten verrichtet hette, da Ihme der alte Soltouw nicht durch verheißung des geldes darzu beweget. Item waß Soltouw wie der mensch erschlagen, vor wort sich verlauten laßen. Ob nicht gedacht wehr, man müßte es heimblich halten.
… (5693) Ad 6 Sedemunt und der Gefangenen Sohn, auch Aßmuß genant, wehren mit dem Mahler einen fußsteig gangen, zwischen Hollenbek und Ancker, auff einen Sontag abend, im mondenschein, und hette damahls Hanß Sedemunt den ermordeten mit einem beill geschlagen, daß er geruffen, Ach, welches er vonferne gesehn.
Ad. 8 Sein Sohn Aßmuß hette Ihm auch mit einem Beillgeschlagen, und sey die wunde im kopff gewesen.
(5707) Actum Ratzeburgk 28 Jan. 1630
Praes: hn. Andrea Hundten, Praefecto in Ratzeburgk Paulo Becker und Friderico Dekwerin(?)
Aßmuß Soltowen von Perkentin und Hanßen Sedemundt von Kohlstorff guhttliche Außage wegen eineß an einem Mahler auff freyer Kayserl. Heerstraßen verübtten frewendlichen Morthatt.
Aßmuß Soltau Ist zu erst absonderlich der beschehenen Morthatt halber, undt durch waß Occasion oder gelegenheit, ehr cum complicibus an den vermordeten Mahler gerahtten befragett Ille berichtet hirauff daß zue Lübeck am Mühlenthor der vermordete zu seinem Sohn, so ein Knecht etwa von 22. Jahren, kommen, undt begehrett, daß sie ihm ein Bündell biß nacher Hamburgk mochten mitt übernehmen mitt dem versprechen zue hamburgk darfüer ihm Biergeldt zuentrichtten, welches ihme Soltouwen der Sohn angezeigett undt hette ehr solches verwilliget, hette auch darauf der Mahler daß Bündell oder den Warttsack etwa halben Armeß lanck undt (5708)
Weniger glimpflich verlief ein Vorfall für den Hauptakteur eines Raubüberfalls auf der Landstraße von Krummesse nach Berkenthin im Jahre 1631. Dahinter steckte ein gewisser Cuno von Hoffmann, verheiratet mit Emerentia von Calben und somit ein Schwiegersohn des in Lübeck hoch angesehenen Lorenz von Calben auf Mori. Dieser in Kriegsangelegenheiten erfahrene Mann, wir befinden uns ja schließlich mitten im 30-jährigen Krieg, hatte im Januar 1631 des Nachts lübsche Kaufleute mit etlichen Reitern überfallen, die Kaufleute verprügelt, verletzt und ihnen Waren im Wert von 70 Reichstalern abgenommen. Die Kaufleute klagten vorm Lübecker Rat, besonders brisant, da doch die von Calben auch Ratsangehörige waren. Trotz Intervention der Familie wurde Hoffmann zum Tode verurteilt. Er wurde am 1. Mai 1632 im Marstall um 4 Uhr morgens mit dem Schwert hingerichtet.
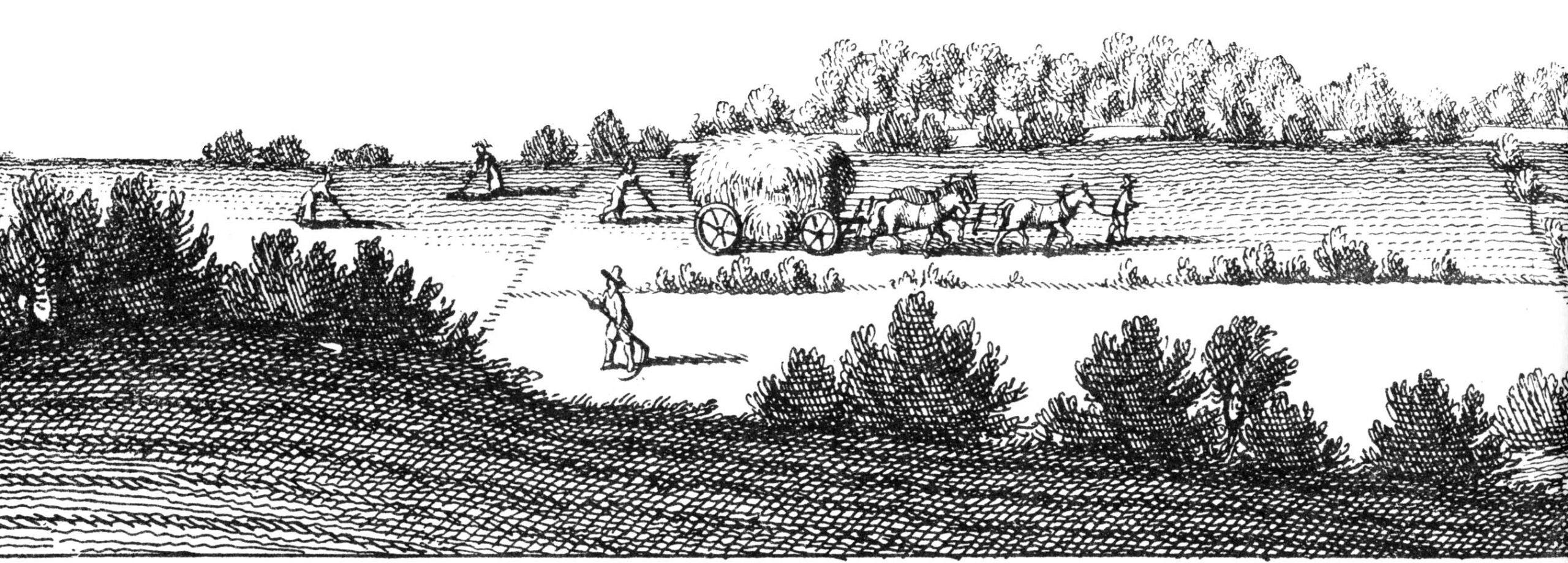 Hans Hack geb. etwa 1610, gest. 23.12.1665 – ein Lebensbild (s.a. Höfe)
Hans Hack geb. etwa 1610, gest. 23.12.1665 – ein Lebensbild (s.a. Höfe)
Bis in die Zeit des 30jährigen Krieges lässt sich die Geschichte der alten Berkenthiner Familie Hack zurückverfolgen, die uns durch die folgenden Jahrhunderte begleiten wird. Die Kenntnis über diese alte Familie verdanken wir der Arbeit Peter Jürs´: Chronik der Familie Hack. Und zwar wird um das Jahr 1640 erstmals ein gewisser Hans Hack als Besitzer der Hufe h in Groß Berkenthin aktenkundig. Er wurde um 1610 geboren und starb am 23.12.1665 in Berkenthin. Woher er kam, lässt sich nur vermuten. Aber möglicherweise stammte er von außerhalb und hat die Stelle entweder gekauft oder sich eingeheiratet. Zwar tauchte schon im Steuerregister von 1557 ein Hans Hack auf, aus der Höhe seine Abgaben (2 Schillinge) lässt sich aber schließen, dass er kein Hufner, sondern ein Kätner gewesen sein dürfte. Weitere Informationen haben wir über ihn nicht. Ob ein Zusammenhang zu dem späteren Hans Hack besteht, ist völlig unklar. Zumindest übernahm dieser Hans Hack mitten im Dreißigjährigen Krieg die alte Hufe h an der heutigen Ratzeburger Straße in Groß Berkenthin, die sich bis in die Gegenwart im Besitz der Familie befindet. Vorher wurden u.a. ein Petter Dohrendorf und ein Lutke Ko(e)p als Besitzer dieser Stelle genannt. Von Hans Hack weiß man, dass er 1640 für den Wiederaufbau des Berkenthiner Pfarrhauses 2 Mark beigetragen hat, später dann noch einmal 3 Mark. Offensichtlich war dieses zuvor abgebrannt, vielleicht im Zuge der Kriegsgeschehnisse. Auch ist gesichert, dass er den Krieg und die Pest überlebt hat, denn aus dem Steuerregister des Herzogs von 1648 geht hervor, dass er „das seinige auch noch bißhero entrichtet (hatte).“
Aus dem Jahr 1659 liegen dann wieder genaue Angaben über die Bauern in Groß Berkenthin vor, so auch über unseren Hans Hack. Nach dem Ratzeburger Urbarbuch besaß er damals eine ganze Hufe, zahlte jährlich 1 Reichstaler 15 Schillinge Pacht und eben so viel Ablager, 18 Schillinge Ochsengeld und gab außerdem 16 Scheffel Hafer, 1 Schneidelschwein, 1 Gans, 2 Hühner, 10 Eier, 2 Pfund Flachs, 4 Pfund Gespinst, diente jährlich 156 Tage mit dem Gespann und stellte 1 Pferd in der Musterung. Es lässt sich ermessen, dass unter dieser hohen Abgabenlast nur ein ärmliches, hartes und arbeitsreiches Leben fristen ließ. Besonders die 156 Tage Gespanndienste dürften ihn besonders gedrückt haben, zumal daneben noch die eigene Hufe bewirtschaftet werden musste.
weiter s. Lauenburgischer Erbfolgestreit – Ein Lebensbild III
Eckardt Opitz (Hrsg.): Herzogtum Lauenburg: das Land und seine Geschichte. Ein Handbuch. Neumünster 2003
Peters Jürs: Chronik der Familie Hack, unveröffentlichtes Manuskrip
Guido Weinberger: http://www.kastorfer-geschichte.de/31.html
Die Lübeckischen Landgüter, von Dr. C. Wehrmann, in: Zeitschrift für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Bd. 7, Seite 151ff.
Kirchenchronik Berkenthin
AHL ASA interna Nr. 19534 „Raubtat und Hinrichtung des David Cuno von Hoffmann, Schwiegersohns des Lorenz von Kalven auf Mori